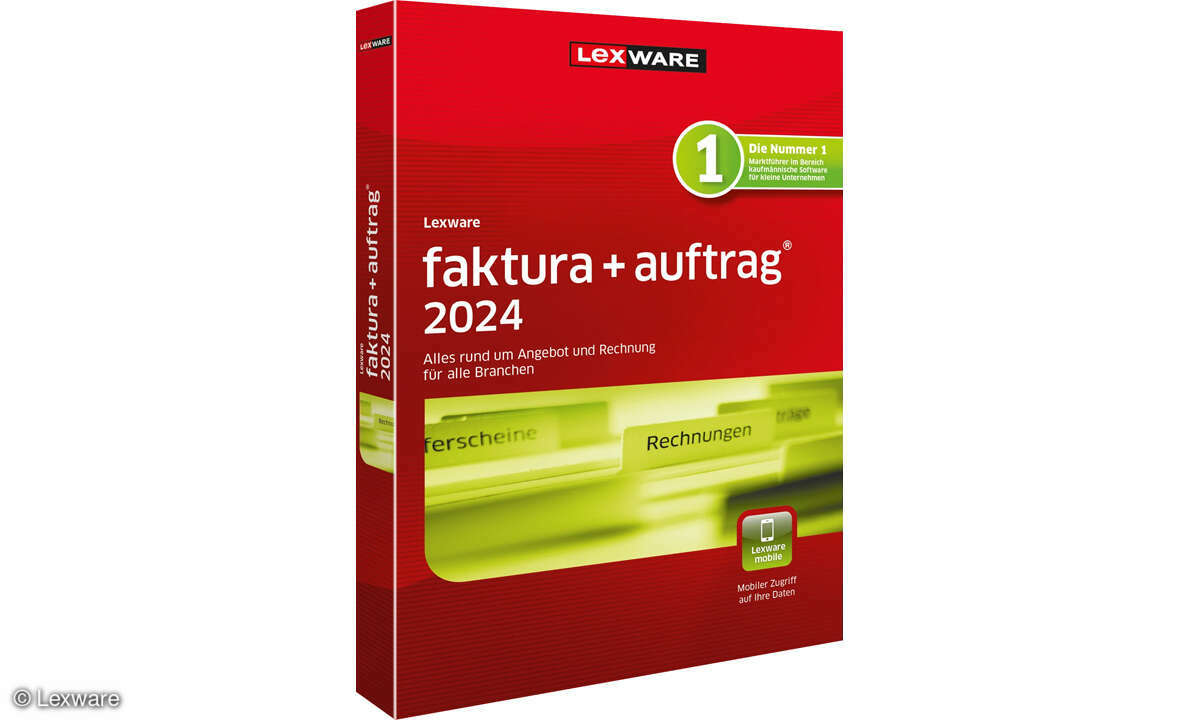German Physiks Unicorn Mk II im Test
Die Unicorn von German Physiks ist sicher nicht das, was man gemeinhin eine Schönheit nennt. Höhe und Tiefe liegen im Normbereich, nicht aber die Breite. Doch kann ihr Klang im Test überzeugen?

Was bewegt einen Hersteller dazu, solch einen Riesen zu bauen? Dahinter steckt ein konsequent audiophiler Ansatz, dessen Verständnis einen Blick auf die technischen Zusammenhänge verlangt. Unabhängig davon: Die klanglichen Fähigkeiten sind atemberaubend und entschädigen für die Optik.Wie alle ...
Was bewegt einen Hersteller dazu, solch einen Riesen zu bauen? Dahinter steckt ein konsequent audiophiler Ansatz, dessen Verständnis einen Blick auf die technischen Zusammenhänge verlangt. Unabhängig davon: Die klanglichen Fähigkeiten sind atemberaubend und entschädigen für die Optik.
Wie alle Produkte der im hessischen Maintal ansässigen Manufaktur arbeitet auch die Unicorn mit dem hauseigenen DDD-Wandler, den German Physiks selbst herstellt und den so kein anderer Hersteller im Programm hat. Die Abkürzung steht für "Dick Dipole Driver" und beschreibt ein komplexes Schwingungsverhalten, das auf der Webseite des Herstellers ausführlich erklärt wird.
Der Wandler arbeitet mit einer großformatigen, konventionell gewickelten Schwingspule und einer streng konischen Membran, die im Falle der Unicorn aus einem Kohlefasergeflecht besteht und vertikal ausgerichtet wird.
Unicorn Mk II: Perfekter Rundstrahler
Diese Membran, etwas respektlos "Tüte" genannt, ist so bemessen, dass sie alle hörbaren Frequenzen mit hoher Linearität und Signaltreue verarbeiten kann. Obendrein wird ein überaus homogenes Rundstrahlverhalten erreicht, das in der Horizontalen keinerlei Einschränkungen unterliegt.
Die Übertragung unterschiedlichster Wellenlängen mit einem Strahler konstanter Größe gelingt durch eine fein austarierte Kombination verschiedener Schwingungsarten. Bei tiefen Tönen verhält sich der Trichter wie ein Kolbenstrahler; mittlere und hohe Anteile dagegen werden vorwiegend durch Biegewellen dargestellt.

Der DDD basiert auf dem mittlerweile gut 50 Jahre alten Walsh-Treiber, der wegen einiger technischer und klanglicher Defizite fast in der Versenkung verschwunden wäre und nun in ungleich modernerer Form weiterlebt.
Bei der Unicorn Mk II darf und muss der Rundstrahler ohne zusätzliche Subwoofer auskommen; daher gibt es keine Frequenzweiche im herkömmlichen Sinne. Um dem nicht sehr flächenstarken, somit tendenziell leisen Treiber einen tiefen und kräftigen Bass zu entlocken, kam für die Ingenieure nur ein verlustarmes Hornsystem infrage.
Da der sehr komplexe Innenaufbau des Bassgehäuses keinerlei Raumreserven bietet, mussten die Bauteile für das zwingend notwendige Subsonicfilter wie auch die Steckbrücken zur Raumanpassung in ein separates Gehäuse verlegt werden, das bequem hinter der Box geparkt wird.
Unicorn Mk II: Enorme Homogenität
Anfänglich irritiert die Unicorn mit einem ungewohnt sanften Klangeindruck, der sich schon nach kurzer Zeit als äußerst wohltuend erweist. Ihrem Klangcharakter fehlt die Verbissenheit, mit der gewöhnliche Mehrwege-Systeme gerne um Aufmerksamkeit buhlen, aber langfristig oft nerven.
Kaufberatung: Top-Speaker um 2.000 Euro
Musikalische Details bot die Unicorn ohne erhobenen Zeigefinger dar; sie waren einfach da, mit allen Facetten und Klangfarben, als ob dies völlig selbstverständlich wäre.
Das bereits mit der Blumenhofer Big Fun 17 gehörte perkussive "Jazz Variants" klang mit der German Physiks zwangloser, feingliedriger, obendrein räumlicher. Großen Anteil am faszinierend stimmigen Gesamteindruck hatte der Bass, der volumenmäßig nicht mal übertrieben stark kam, dafür aber zeitlich perfekt eingebunden schien.
Trotz ihrer knappen Membranfläche gelangen der Unicorn beachtlich hohe, für die meisten Anwender vermutlich völlig ausreichende Pegel; allerdings waren dazu deutlich kräftigere Endstufen erforderlich als bei der Blumenhofer. Keine Frage, hier ist den hessischen Tüftlern ein im besten Sinne der Wortes audiophiler Wandler gelungen. Skeptiker überzeugen sich einfach selbst, zum Beispiel auf der HIGHEND-Messe in München, die Anfang Mai öffnet.
Meinung
Der technisch einzigartige DDD-Wandler erzielt dank perfektem Abstrahlverhalten ebenso hochauflösende wie natürliche Klangbilder. Mit der puristischen Unicorn, die ganz ohne nachhängende Basstreiber auskommt, treibt German Physiks das Prinzip auf die Spitze.
Unicorn Mk II: Technik im Detail
Hornartige Schallführungen verbessern generell die Schalldruckausbeute, führen aber nicht zwangsläufig zu einem gigantisch hohen Wirkungsgrad. Der DDD der Unicorn ist dazu als Ausgangsbasis einfach zu leise. Hier geht es mehr darum, aus einem nur maßvoll effizienten Treiber, dessen Verschiebevolumen nicht zuletzt wegen der biegeweichen Membran recht begrenzt ist, trotz aller Limitierungen einen musikalisch vollwertigen Bass zu kitzeln.
Praxis: Lautsprecher richtig aufstellen
Tatsächlich ist der Biegeschwinger lauter und belastbarer, als man zunächst denkt. Die branchenüblichen Messungen in reflexionsarmen Räumen liefern bei Rundstrahlern zu niedrige Werte, weil sie nur einen kleinen Winkelbereich erfassen. In der Praxis ist die Unicorn etwa so watthungrig wie eine Kompaktbox und daher für zierliche Röhrenverstärker nur bedingt geeignet. Auch die sehr stark schwankende Impedanz, die in der Spitze bis über 100 Ohm hinaufschießt, spricht gegen den Einsatz von Röhren.