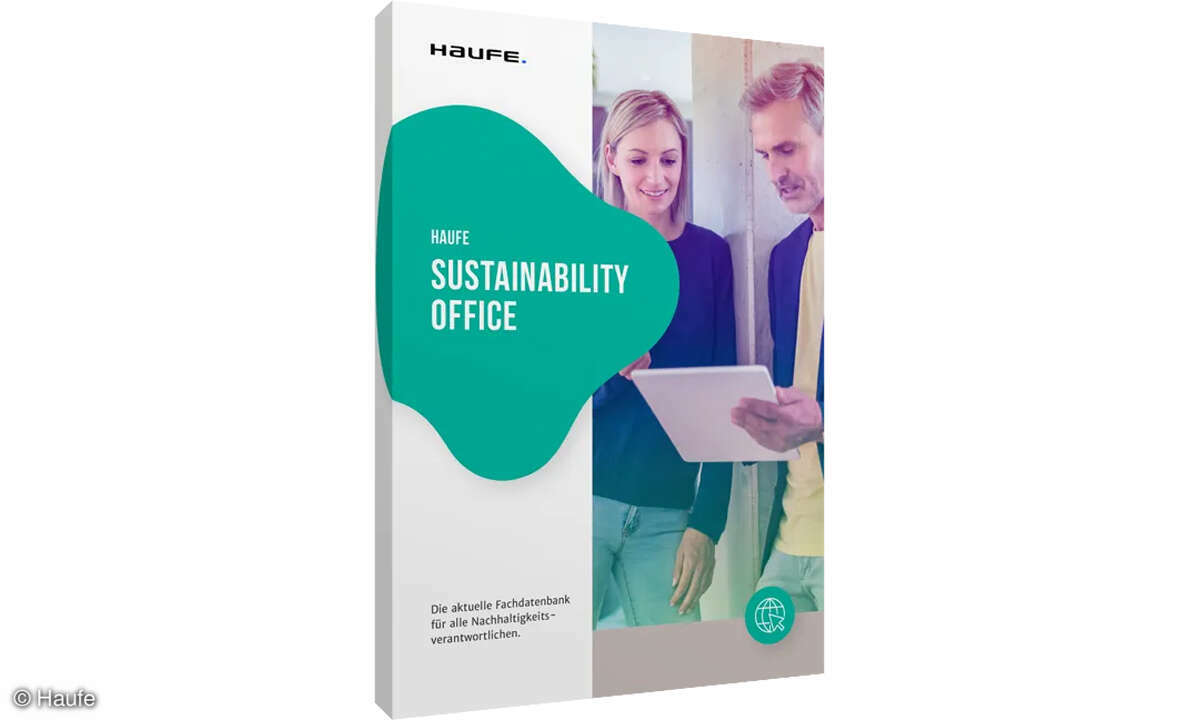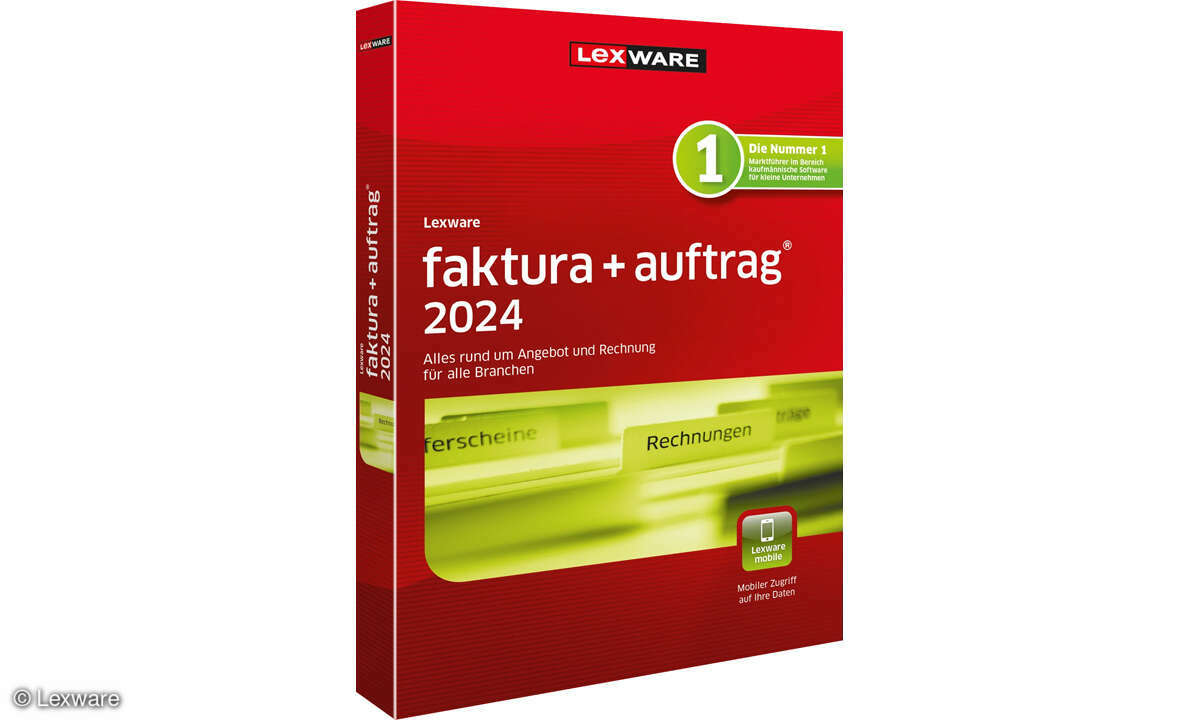Transrotor Zet 3 + Tonarm 5009 + Netzteil Konstant
Plattenspieler von Transrotor stehen für höchste Präzision, viel Handarbeit und Klangstärke. Das beweist auch der Zet 3 + Tonarm 5009 + Netzteil Konstant (5320€)

- Transrotor Zet 3 + Tonarm 5009 + Netzteil Konstant
- Datenblatt
Es gibt nur wenige Hersteller, deren Produkte einen solch hohen Wiedererkennungswert haben haben wie die von Transrotor. Denn auch ohne das Typenschild ist ein Plattenspieler aus der Manufaktur in Bergisch Gladbach unverkennbar. Dabei macht die Optik mit viel Acrylglas und blankpoliertem Aluminiu...
Auch hier gibt es Acryl und handpoliertes Aluminium satt zu bewundern, während die Verarbeitungsqualität und das edle Erscheinungsbild sich mit einem Luxusauto vergleichen lassen, etwa von Bentley. Aber durch Optik und Aura alleine wird ein Plattenspieler noch lange nicht klanglich gut. Dafür braucht es deutlich mehr. Zum Beispiel eine stabile Basis. Die hat Räke durch zwei Acrylplatten realisiert, zwischen denen eine Aluminiumschicht liegt. Dadurch wird nicht nur die Masse erhöht, sondern auch die Resonanzanfälligkeit verringert. Dass die drei Schichten nicht einfach aufeinandergeklebt sind, sondern mit sieben Schrauben fest verbunden, verdeutlicht die Bemühungen um eine solide Grundlage für den Zet 3.
Beim Lager verlässt sich Transrotor auf eine bewährte Konstruktion mit Bronze-Büchse und Edelstahlachse, die sich auf einer Stahlkugel dreht. Doch auch hier gibt es Feinarbeit zu bestaunen. So reicht es Räke nicht, beide Teile mit niedrigsten Toleranzen zu fertigen und zusammenzufügen, nein, danach lässt er das Teil an der Achse einspannen und den Subteller nochmals abdrehen, was die letzte Exzentrizität beseitigt.
Auch der Teller sowie die Basis des Lagers werden nicht nur per Hand hochglanzpoliert, sondern bekommen wellenförmige Ausfräsungen, was Resonanzen mindert. Ein weiterer Beweis für die mechanische Genauigkeit ist die Tellermatte aus einem Gemisch aus Grafit und Acryl. Sie wird zuerst ausgestanzt und dann abgedreht, um selbst hier keine Exzentrizität zu erlauben.
Wie bei einem guten Auto spielt auch bei einem Plattenspieler der Motor eine wichtige Rolle. Bei Transrotor kommt deshalb ein Modell von der Stange nicht in Frage. Räke wählte eine Variante, die zwei zehnpolige Einheiten besitzt. Diese lassen sich fein gegeneinander austarieren, was bei Transrotor per Handarbeit erledigt wird, sodass der Motor mit geringstmöglichen Vibrationen läuft. Um die letzten Reste von Zittern zu eliminieren, spannt ihn Räke innerhalb eines massiven Aluminiumblockes in eine Aufhängung aus Kunststoff und Silikongummi ein.
Für die Versorgung des Motors gibt es zwei Varianten: eine einfache mit Steckernetzteil und Phasenschieberschaltung und die genauere Motorelektronik Konstant. Letztere empfiehlt sich durch einen analogen Generator (Wien-Brücke), der eine äußerst konstante und saubere Schwingung erzeugt. Darüber hinaus lässt sich die Drehzahl feineinstellen und bietet den bequemen Wechsel zwischen 33 1/3 und 45 Umdrehungen per Umschalter.
Die Bestandteile des brandneuen Tonarms Transrotor 5009 werden manchem Analogfreund bekannt vorkommen. Denn hier hat sich Räke bei SME bedient und einen Arm maßschneidern lassen. Er setzt sich aus Teilen des SME 309 und des SME V zusammen. Das Magnesiumrohr, die Lager und die Silber-Verkabelung gönnte sich Räke vom Topmodell V, während die anderen, klanglich weniger relevanten Teile vom 309 stammen. So wird die Auflagekraft nur per Gegengewicht eingestellt, und auch die Möglichkeit der Tiefenresonanz-Bedämpfung via Silikonbad entfällt.
Um den horizontalen Winkel, mit dem die Nadel in die Rille taucht (Azimut), verändern zu können, lässt Räke die feste Headshell absägen und eine verschraubte ansetzen. So kann man nicht nur schnell die Headshell tauschen und somit auf ein anderes montiertes System wechseln, sondern auch sicherstellen, dass die Nadel an beiden Rillenflanken den gleichen Kontakt hat, was dem Klang zu Gute kommt.

Im Hörraum stellte sich nach der peniblen Austarierung des Zet 3 zuerst die Frage, ob man die mitgelieferten Gummidämpfer verwenden soll. Doch auch wenn die Jury ob der feineren und artikulierteren Wiedergabe eher zu der Entkopplung mit den Gummipuffern neigte, kann dies in Ketten mit etwas unkonturierterem Bass anders ausfallen. Denn die direkte Ankopplung lieferte den festeren Bass und das etwas konkretere Klangbild.
Der Vergleich der Motorversorgungen führte hingegen zu einem eindeutigen Ergebnis: Die Konstant distanzierte die Basisvariante mit genauerer Ortbarkeit von Einzelinstrumenten und vermittelte in leisen Passagen deutlich mehr Spannung. Zudem wirkten Orchestertuttis durchhörbarer, weshalb stereoplay den Zet 3 mit der Konstant einpunktete.
Mit dieser Motorelektronik und dem Referenz-Abtaster Transfiguration Orpheus (Test 11/06) beeindruckte der Zet 3 mit 5009-Tonarm durch exemplarische Ausgeglichenheit. So drängte sich kein einziger Teilaspekt in den Vordergrund, sondern jeder fügte sich in das Gesamtgeschehen nahtlos ein. Etwa der tiefe, druckvolle Bass, der niemals unsauber den Grundton verwischte. Oder die feinen Höhen, die in keinem Fall aufgesetzt wirkten. Die Raumwiedergabe mit genauer Ortung von einzelnen Instrumenten geriet großzügig. Wenn jemand überhaupt etwas an diesem Transrotor kritisieren mag, dann vielleicht, dass der Zet 3 durch seine entspannte Musikalität ein wenig Ecken und Kanten vermissen ließ. Doch wer vermisst in einem Bentley das Holpern durch die Kurven?
Transrotor Zet 3 + 5009 + Konstant
| Transrotor Zet 3 + 5009 + Konstant | |
|---|---|
| Transrotor Zet 3 + 5009 + Konstant | |
| Hersteller | Transrotor |
| Preis | 5320.00 € |
| Wertung | 54.0 Punkte |
| Testverfahren | 1.0 |