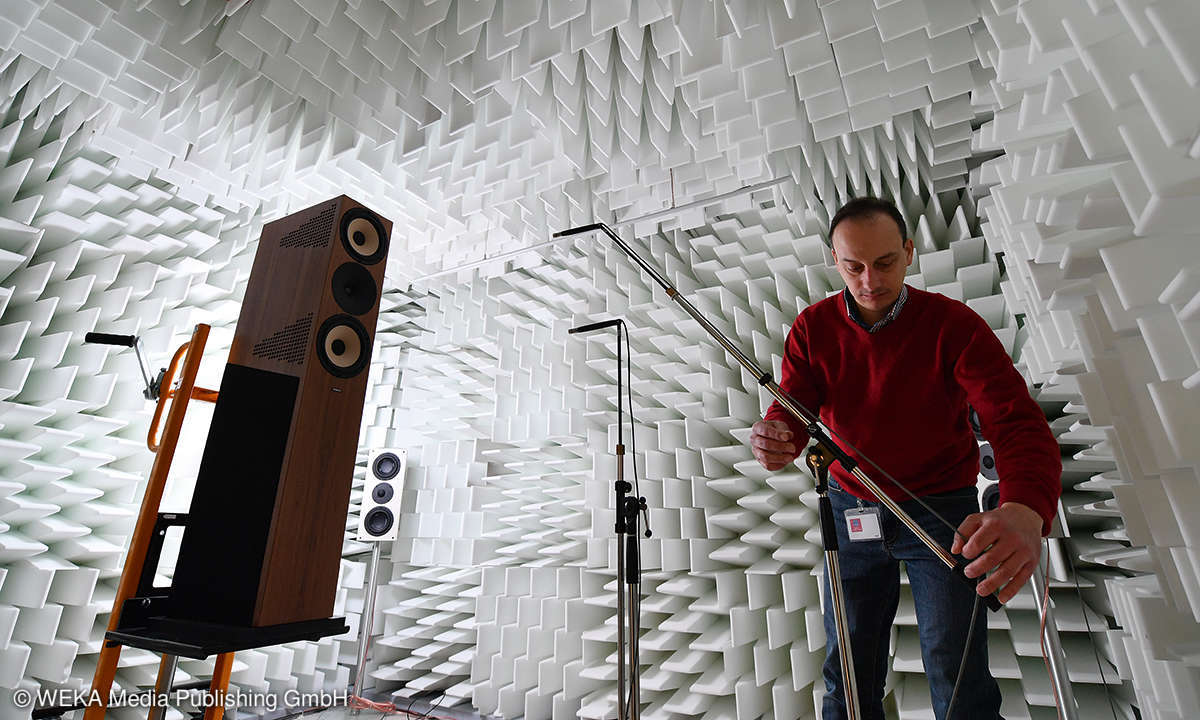Tonarm und Tonabnehmer: Darauf kommt es an
In diesem Artikel verraten wir, worauf es beim Tonarm und Tonabnehmer ankommt, damit Sie optimalen Klang genießen.

In der Kombination von Tonabnehmer und Tonarm steckt mitunter ein Kompatibilitätsproblem. Bei ungünstiger Paarung ergibt sich eine tieffrequente Resonanz, die man an einer langsam pumpenden Bewegung des Tieftöners erkennt.Die Nadel eines Tonabnehmers muss sich mit der Rillen-Modulatio...
In der Kombination von Tonabnehmer und Tonarm steckt mitunter ein Kompatibilitätsproblem. Bei ungünstiger Paarung ergibt sich eine tieffrequente Resonanz, die man an einer langsam pumpenden Bewegung des Tieftöners erkennt.
Die Nadel eines Tonabnehmers muss sich mit der Rillen-Modulation möglichst ungehemmt und frei bewegen können. Im Idealfall hätte die Abtastnadel keine eigene Masse und könnte daher quasi trägheitslos den Auslenkungen folgen. Doch das ist natürlich Wunschdenken, denn Nadel und Nadelträger müssen mit den bewegten Spulen verbunden und im Magnetspalt befestigt sein. In der Praxis und bei üblicher Bauart von MC-Abtastern sitzt der Nadelträger am hinteren Ende mit dem Spulenträger auf einem winzigen Gummi und wird mit einem Spanndraht (gegen den Gummi gezogen) weiter hinten am Generatorsystem befestigt.
Es leuchtet ein, dass dieses Ensemble die nötige Auflagekraft und die bewegte Masse des Tonarms aushalten muss (damit der Tonabnehmer nicht "auf dem Bauch" liegt). Gleichzeitig soll sich das Spulen-Ensemble bei Nenn-Auflagekraft in optimaler Lage im Magnetspalt befinden.
Etwas vereinfacht formuliert, muss bei einem Tonabnehmer also ein vernünftiger Mittelwert zwischen der Steifigkeit des bewegten Systems und dessen Fähigkeit, den Auslenkungen möglichst schnell zu folgen, angestrebt werden. Macht man den Tonabnehmer zu "weich", kann er zwar gut abtasten, besitzt aber auch wenig eigene Dämpfung und benötigt einen superleichten Tonarm, der womöglich schlecht führt und zu Resonanzen neigt. Macht man den Abtaster dagegen zu "hart", folgt er den Rillen-Auslenkungen nur gehemmt, was seine Abtastfähigeit verschlechtert, die Verzerrungen erhöht und (auch durch die dann nötige höhere Auflagekraft) die Kräfte zwischen Nadel und Rille vergrößert, worin Verschleißgefahren stecken.
Compliance
Wie man unschwer sieht, stellt ein Tonabnehmer einen hoffentlich guten Kompromiss zwischen verschiedenen Faktoren dar. Seine Nadel-Aufhängung ist durch die sogenannte Compliance definiert, die angibt, wie nachgiebig diese Aufhängung ist. Je kleiner der Wert der Compliance ist, desto härter ist der Nadelträger aufgehängt.
Die Maßeinheit für die Compliance ist Mikrometer pro Millinewton. "Harte" Tonabnehmer liegen gewöhnlich im Bereich von 5 bis 10, "mittlere" Abtaster befinden sich bei etwa 10 bis 20, während "weiche" Systeme eine Compliance von bis zu 35 Mikrometer pro Millinewton aufweisen, wobei letzterer Fall heutzutage so gut wie nicht mehr anzutreffen ist. Auch deshalb, weil man sich schon lange zu Recht von der 80er-Jahre-Mode möglichst hoher Abtastfähigkeit verabschiedet hat.
Das Federpendel
In der Kombination der federnd aufgehängten Nadel mit einem beweglichen Tonarm und den beteiligten (bewegten) Massen entsteht ein schwingfähiges System, das physikalisch betrachtet ein klassisches sogenanntes Federpendel darstellt. Also das Äquivalent zu einer oben aufgehängten Feder, an deren unterem Ende ein Gewicht angebracht ist. Wer diesen Versuch in der Schulphysik absolviert hat, der weiß, dass dieses Pendel bei einer bestimmten Frequenz ganz besonders gerne schwingt, nämlich bei seiner Resonanzfrequenz, die durch die Federkonstante (im Prinzip die "Härte" der Feder) und die aufgehängte Masse bestimmt wird.

Äquivalent dazu besitzt auch das System aus Tonabnehmer und Tonarm eine Resonanzfrequenz, die durch die beteiligten Massen (Eigengewicht des Abtasters plus effektive Masse des Tonarms) und durch die Compliance festgelegt wird. Bei der effektiven Masse eines Tonarms handelt es sich präziser gesagt aber nicht um das Gewicht der bewegten Teile, sondern um deren Massenträgheitsmoment.
Der Resonanzfall
Tritt nun dieser Resonanzfall ein, kann sich das System so weit aufschwingen, dass im Extremfall die Nadel aus der Rille geworfen wird. Doch auch schon das sichtbare Auf- und Abschaukeln des Tonarms mit deutlich erkennbaren, meist in senkrechter Ebene stattfindenden Eintauchbewegungen des Nadelträgers kennzeichnet den Resonanzfall. In weniger gravierenden Fällen sieht man praktisch nichts, wird aber durch sichtbares, subsonisches "Pumpen" des Tieftöners oder auch durch schnelle Tonhöhenschwankungen darauf aufmerksam gemacht, dass hier etwas überhaupt nicht stimmt.
Wie auch beim echten Federpendel wird der Resonanzfall erst durch eine Anregung im Bereich der Resonanzfrequenz herbeigeführt. Beim Plattenspieler kann das eine entsprechend tieffrequente Auslenkung des Nadelträgers oder auch schon eine simple Platten-Verwellung sein. Weitere potenzielle Anregungen sind (unter anderem) Subchassis (selbst wiederrum Federsysteme), tiefstfrequenter Luftschall oder durchgeleiteter Trittschall. Man ist deshalb bemüht, die unvermeidliche Resonanzfrequenz einer Tonarm-/Tonabnehmer-Kombination so zu legen, dass sie die Wiedergabe möglichst wenig beeinflusst.
Das bedeutet, heraus aus dem Hörbereich (also unterhalb von 20 Hertz), aber auch nicht so tief, dass Plattenverwellungen (die, wie Untersuchungen zeigten, fast durchweg in einem Bereich unterhalb von acht Hertz angesiedelt sind) die Resonanz anregen könnten. Als optimaler Bereich gelten etwa sieben bis zwölf Hertz, weshalb man bestrebt ist, die Nadelnachgiebigkeit und die beteiligten Massen - also die effektive Masse des Tonarms, das Gewicht der Headshell (falls vorhanden) sowie das Eigengewicht des Tonabnehmers und seiner Befestigungsschrauben - entsprechend zu kombinieren.
Die Formel
Und das geht, obwohl die Formel dazu simpel ist, auch ganz ohne Mathematik. Denn natürlich haben findige Köpfe, die uns das Audio-Leben leicht machen wollen, entsprechende Tabellen und Grafiken gebaut, die wir konsultieren können. Dabei geht es nicht um ein Gramm oder ein Hertz hin oder her, sondern mit freundlicher Toleranz um die grundsätzliche Lage der Resonanzfrequenz im "gutartigen" Bereich.

So halten etwa die Analogspezialisten von Ortofon die "Gegend" von minimal 6,5 Hertz und maximal 14 Hertz für unschädlich. Zumal hier auch noch andere Faktoren Einfluss nehmen können, über die wir gleich sprechen werden.
Diagramme und Tabellen
Bei bekanntem Tonabnehmer-Eigengewicht, der Nadelnachgiebigkeit und angegebener effektiver Masse eines Tonarms lässt sich also zunächst abschätzen, in welchem Bereich sich eine potenzielle Kombination bewegt. Dabei helfen auch Tabellen mit Angaben zu Tonarmen, Tonabnehmern oder Komplett-Plattenspielern im Internet, beispielsweise unter www.vinylengine.com oder auch bei www.new-hifi-classic.de.
Hier hat der deutsche HiFi-Enthusiast Jürgen Heiliger eine der umfangreichsten Datensammlungen überhaupt zu Tonarmen und Abtastern zusammen getragen. Mit seinem Tonarm-Resonanzkalkulator steht dort auch eine Tabellenkalkulation zur Verfügung, in die man eigene Daten eintragen kann, um eine Tonarm-/System-Paarung zu checken. Durch die beiden Beispiele eines "harten" und eines "weichen" Tonabnehmers lässt sich bei bekannter effektiver Tonarmmasse auch schon grob abschätzen, ob man mit einem ähnlichen Abtaster noch im sicheren Bereich liegt.
Extrem schwere Tonarme (> 35 g effektive Masse) sind heutzutage aber nur noch selten anzutreffen. Und Tonarm-Hersteller, die auf die Angabe der effektiven Masse ihres Produkts verzichten, müssen sich Nachfragen wohl gefallen lassen; immerhin geht es hier um eine ganz entscheidende Eigenschaft ihres Produkts... Und das gilt natürlich entsprechend auch für die Nadelnachgiebigkeit von Tonabnehmern!
Testplatten
Die meisten üblichen Testplatten - sofern es sich nicht um wenig aussagefähige "Testplatten" mit reinen Musikbeispielen handelt - bieten spezielle Tracks zur Überprüfung der Lage der Resonanzstelle. Dazu benutzt man Tracks, die lateral und vertikal geschnittene, subsonische und deshalb unhörbare Anregungsfrequenzen zwischen fünf bis 15 oder auch zwischen sechs und etwa 16 Hertz enthalten. Clever gemachte Testplatten unterlegen diese tiefen Frequenzen mit einem Pilotton, der an der Resonanzstelle eine hörbare Modulation annimmt. Üblicherweise äußert sich die Resonanz klar feststellbar durch einen "zwitschernden" oder "trillernden" Pilotton. Für diesen Test sollte man den Pegel der Anlage natürlich sicherheitshalber weitgehend herunterregeln und, falls vorhanden, auch das Subsonic-Filter aktivieren.
Hier sind wir an einem Punkt, der verdeutlicht, wie unsinnig extrem tiefe untere Grenzfrequenzen bei Verstärkern sind. Gerade bei der Wiedergabe von Schallplatten, wobei subsonische Signale allein schon durch kurze Plattenverwellungen ausgelöst werden können, stellen Subsonic-Filter (oder durch Übertrager oder entsprechend dimensionierte Koppelkondensatoren ohnehin bandbreitenbegrenzte Schaltungen) keine Klangverhinderer, sondern im Gegenteil eine klare klangliche Verbesserung dar.
Bedämpfung
Die in der Plattenspielertechnik schon sehr früh aufgekommene Idee, Tonarme zu bedämpfen, um etwaige Resonanzen klein zu halten oder weitgehend zu unterdrücken, hat sich zwar je nach Ausführung mehr oder weniger bewährt, ist aber inzwischen quasi aus der Mode gekommen.
An die mit dickflüssigem Silikon gefüllten Dämpfungswannen, die optional an SME-Tonarme montiert werden konnten, wird sich mancher noch erinnern. Exotische Tonarme, wie beispielsweise Well Tempered Lab, benutzen gar einen in einem Silikonbad schwimmenden Golfball, der gleichzeitig als Lager und Bedämpfung dient. Ebenfalls (auch) zur Dämpfung wurden früher am Tonabnehmer mitlaufende Bürstchen gesichtet, während heutzutage etwa magnetische Lagerungen durch den Abstand der Haltemagnete mehr oder weniger bedämpft werden können.

Speziell bei Einpunkt- oder Spitzenpunkt-gelagerten Tonarmen, die prinzipbedingt zum Kippeln in horizontaler Ebene neigen, sind stabilisierend wirkende Dämpfungen häufig anzutreffen. Bedenkenswert ist freilich, dass viele Formen von Dämpfung gleichzeitig die möglichst reibungsarme Schwenkbewegung eines Drehtonarmes behindern, was unmittelbar zu unerwünschten Kräften am Nadelträger führt. Prinzipiell wirken sogar Antiskating-Vorrichtungen bedämpfend, ebenso wie vorgespannte Lager oder mit Öl gefüllte Lagerungen. Wie und ob sich eine Resonanz genau auswirkt, hängt daher auch sehr stark von der Bauweise eines Tonarms ab.
Tipps und Tricks
Die effektive Masse eines Tonarms (und damit die Lage der Resonanzstelle) lässt sich durchaus beeinflussen. Unterschiedlich schwere Headshells und Tonabnehmer-Befestigungsschräubchen (es muss nicht immer Stahl sein, auch Alu- oder Kunststoffschrauben sind geeignet) sowie etwa auch Zusatz-Gegengewichte sind Stellschrauben an der effektiven Masse. Zudem sollte man das Eigengewicht von Tonabnehmern im Auge behalten, das inzwischen durch den wenig an der Sache orientierten Material-Fetischismus bei Tonabnehmer-Gehäusen die seltsamsten Schwergewichtsblüten treibt; mitunter passen solche eher künstlerischen Kreationen mit der dann nötigen, sehr niedrigen Compliance nur noch an die heute raren superschweren Tonarme.
Behelfen könnte man sich auch durch Zusatzgewichte oben auf der Headshell oder am Tonarmrohr; zwischen Abtaster-Oberseite und Headshell eingelegte Metall-Zwischenplättchen machen einen Tonarm ebenfalls "schwerer". Das hat freilich konstruktive Grenzen und es leuchtet ein, dass man einen Tonarm nur etwas schwerer, aber gewöhnlich nicht leichter machen kann. Ausnahme: geteilte Gegengewichte oder Tonarme mit wechselbaren Armrohren.