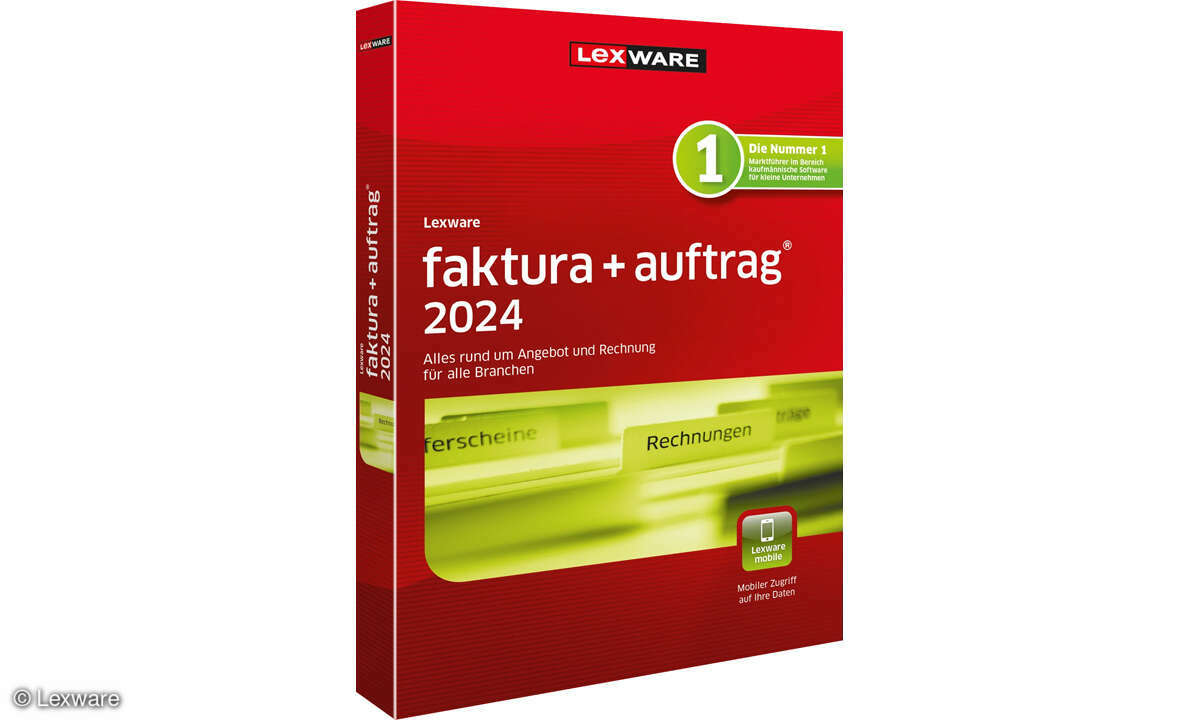Linn Exakt-Box im Test
Die Linn Exakt-Box erweist sich im Test als voll digitale, vorprogrammierte Frequenzweiche. Sie bringt perfekte Zeitrichtigkeit, korrigiert Raumakustikprobleme und streamt verlustfrei. Die Idee, Passivboxen zu aktivieren, ist alt. Revolutionär ist jedoch Linns neuer Ansatz

Die meisten voll digitalen Aktivkonzepte, wie man sie von Linn, B&M und Meridian kennt, sind zumeist proprietäre Systeme: Man kauft sich die komplette Kette, streamt verlustfrei bis in die Box, fertig... Weder kann man die alten Komponenten seiner klassischen HiFi-Anlage weiternutzen (mit Ausna...
Die meisten voll digitalen Aktivkonzepte, wie man sie von Linn, B&M und Meridian kennt, sind zumeist proprietäre Systeme: Man kauft sich die komplette Kette, streamt verlustfrei bis in die Box, fertig... Weder kann man die alten Komponenten seiner klassischen HiFi-Anlage weiternutzen (mit Ausnahme des zum Datenlieferanten reduzierten CD-Players vielleicht), noch lässt sich am System selbst irgendetwas austauschen, verbessern oder tunen.
Was des reinen Musikhörers Freud', ist dem High-Ender, der gern schrittweise seine Anlage verbessert, einzelne Komponenten austauscht und letztlich zur klanglichen Seligkeit aufsteigt, ein Graus. Dieses philosophische Manko der technisch und klanglich über jeden Zweifel erhabenen Digitalkette Exakt Akubarik muss man auch in Glasgow erkannt haben - und sann auf eine Lösung des Problems. Die nennt sich Linn ExaktBox, sieht von vorn unscheinbar wie eine Endstufe aus.
Das Konzept lässt sich nicht mit einem Satz erklären: Rein formal handelt es sich um eine voll digitale aktive DSP-Frequenzweiche, die ihre hochauflösenden Signale ausschließlich vom bekannten Digital-Streamer/Vorverstärker Exakt DSM über das proprietäre, besonders Jitter- und verlustfreie Protokoll Exakt Link erhält und noch auf digitaler Ebene in wahlweise bis zu zweimal fünf Wege aufsplittet.
Doch dann bleiben die nun für die Chassis perfekt gefilterten und aufbereiteten Signale nicht im proprietären Linn-System, sondern stehen per XLR- oder Cinch-Ausgang jeder beliebigen Kombination von Endstufen zur Verfügung. Steckbare Filtermodule, anpassbare Regler oder manuelle Einstellungen entfallen, denn mit der hauseigenen Software Linn Control wird die gesamte Frequenzweiche eines bestimmten Boxentypus auf digitaler Ebene emuliert und in die Exaktbox geladen.
Aktiv ersetzt passiv
Dort übernimmt sie nicht nur die vormaligen Aufgaben der passiven Filter, die zu diesem Zweck überbrückt (bei Linn-Boxen per Stecker) bzw. aus der Box entfernt (bei Fremdfabriken mit eingebauter Weiche) werden müssen. Damit profitiert die somit digital aktivierte Kette nicht nur von den genaueren und verlustfreien Filtern der digitalen Signalprozessoren (DSPs), es können auch Zeit- und Frequenzgangfehler der einzelnen Treiber genaustens korrigiert werden, was selbst bei Vier- oder Fünf-Wege-Konstruktionen mit Bassreflex, wie sie bei Linn nicht selten sind, zu einem absolut perfekten Timing in allen Frequenzbereichen führt.

Zusätzlich können Frequenzgangfehler und kleinste Abweichungen zwischen linker und rechter Box korrigiert werden, sofern die Messungen der individuellen Chassis oder der Box im Linn-Werk vorliegen. Eine solchermaßen verbesserte Paargleichheit kann die Stereo-Abbildung, Räumlichkeit und Genauigkeit deutlich verbessern. Dass eine solchermaßen aktivierte Kette zudem von den "normalen" Aktiv-Vorteilen profitiert, etwa der direkten Kontrolle jedes Endstufenzweiges auf das jeweilige Chassis oder das Vermeiden von Unlinearitäten der passiven Bauteile, versteht sich fast von selbst.

Bei der Wahl der Endstufen ist der zukünftige aktive Linn-User auch völlig frei, es müssen nur ausreichend Kanäle zur Verfügung stehen, und alle Endstufen sollten, wenn nicht ohnehin identisch, denselben Verstärkerfaktor aufweisen. Im hauseigenen Portfolio finden sich glücklicherweise neben Zwei- auch kompakte Vier- und Sechs-Kanal-Modelle, was die Kombination einer solchen Anlage übersichtlich macht.

Eine andere Klangwelt
stereoplay hörte die bereits 2011 als analogaktive Variante getestete Kombination der Vier-Wege-Box Majik Isobarik und je einer Vier-Kanal-Endstufe Majik 4100 pro Seite. Die Isobarik mit ihrer betont warm-sanften Abstimmung (die nicht jedem gefällt), profitierte damals nur in Teilbereichen von der analogen Aktivierung. Etwas höhere Detailauflösung und ein besseres Lösen des Klangbildes von den Boxen notierten seinerzeit die Tester, aber eben keine klangliche Revolution. Die stand dagegen mit der digitalen Aktivierung nebst vollständiger Entzerrung von Frequenzgang und Timing ins Haus; die Raumkorrektur blieb, im stereoplay-Hörraum ohnehin beinahe unnötig, zunächst deaktiviert).
Bei Leonard Cohens "Songs From The Road" war es tatsächlich so, als spielte hier eine komplett andere Box: Der übertrieben heimelige Charakter, der Details und musikalische Attacken schon einmal leicht diffus verweichlichte, war wie weggeblasen. Die Isobarik punktete mit einer transparenten, monitorhaft hochauflösenden Vorstellung, ohne dabei ihre seidigen Grundqualitäten einzubüßen. Die Bühne, vormals eher andeutungsweise in die Breite dargestellt, erschien noch holografisch projiziert in alle drei Raumdimensionen und hinterließ vor allem ob ihrer genauesten Positionierung der Stimme in der Tiefe sprachlose Tester. Hörte man vorher noch Anflüge der Vier-Wege-Aufteilung, erschienen nun alle Frequenzbereiche, gerade Stimmen und Grundton, wie aus einem homogenen Guss - ganz als spielte hier ein ansonsten fehlerfreier Breitbänder.

Wie wichtig die Timing-Korrektur ist, lässt sich durch Deaktivieren per Software nachvollziehen: Ohne Zeit- und Chassis-Korrektur blieb zwar der ultimativ transparente, geschlossene Eindruck der aktivierten Isobarik erhalten, doch Bässe tönten nicht mehr ganz so auf den Punkt. Auch bei der perfekt homogenen Räumlichkeit musste man wieder leichte Abstriche in Richtung Laisserfaire machen.
Also werden wieder alle Korrekturen aktiviert: Otis Taylors "Cold At Midnight" mit einem treibenden Rhythmus und seinen perfekt getimten Einwürfen von E-Gitarre und Trompete geriet der Isobarik zum Triumphzug: Noch keine Box hatte perfekte Impulse, knochentrockenen Bass und entspannende Sanftheit so harmonisch vereint wie diese außergewöhnliche Kette. Ein Fanal für die Aktivtechnik, die auch Passivfans glücklich machen kann!
Frequenzweichen per Software
Technisch gesehen, lässt sich jede Frequenzweiche emulieren - sie muss nur im Linn-Werk durchgemessen und ihr Pendant digital hinterlegt werden. Zum Anfang ist dies für viele aktuelle und historische Linns der Fall: etwa Komri, passive Akubarik, Akurate, Keltik, Espek, Majik 140 und Isobarik. Zu Demo- Zwecken gibt es aber auch schon ein Weichen-Preset für die B&W-Nautilus-Schnecke, weitere beliebte Modelle von Drittherstellern sind in Vorbereitung.

Setup und Raumkorrektur per PC
Das Setup für Frequenzweiche und Raumkorrektur lässt sich mit der hauseigenen Linn Control Software erledigen. Sobald die Quelle, hier der Exakt DSM, und die Frequenzweiche Exakt- Box als Zielgerät erkannt sind, lassen sich die Boxentypen aus der Auswahl der im Werk durchgemessenen Lautsprecher definieren. Die Zielkurve für alle Frequenzweichenfilter werden dann geladen, der Belegungsplan der Frequenzweichen-Ausgänge wird grafisch angezeigt (von zwei bis fünf Wege ist alles möglich). Handelt es sich um ein Linn-Modell, können per Eingabe der Seriennummer sogar die individuellen Messungen der Chassis berücksichtigt werden, was neben den emulierten Filtern eine automatische Korrektur von Frequenzgang, Übergangsfrequenzen und Timing aktiviert.

Anschließend kann man definieren, welche Box die linke und welche die rechte ist, und schon kann es mit dem zeit- und frequenzgangkorrigierten Musikgenuss losgehen. Theoretisch, denn in der Praxis sollte man auch noch die vorhandene Raumkorrektur nutzen, die genauso funktioniert wie in der Komplettkette Exakt Akubarik: Man gibt die Raumabmessungen Länge, Höhe und Breite ein sowie die Abstände der Boxen-/ Hörerpositionen zur hinteren und zur seitlichen Wand.
Anschließend berechnet das System eine idealisierte Korrekturkurve, bei der Raummoden, Schalladditionen an der Wand und andere Effekte berücksichtigt werden. Eine Messung ist deshalb nicht notwendig; wie stark die Korrekturkurve wirkt, lässt sich regulieren, was gerade bei besser bedämpften Räumen oder solchen mit Leichtbauwänden ein Überregulieren verhindert. Halbparametrische Shelve-Filter ermöglichen zusätzlich eine Anpassung des tonalen Charakters an die Raumakustik.