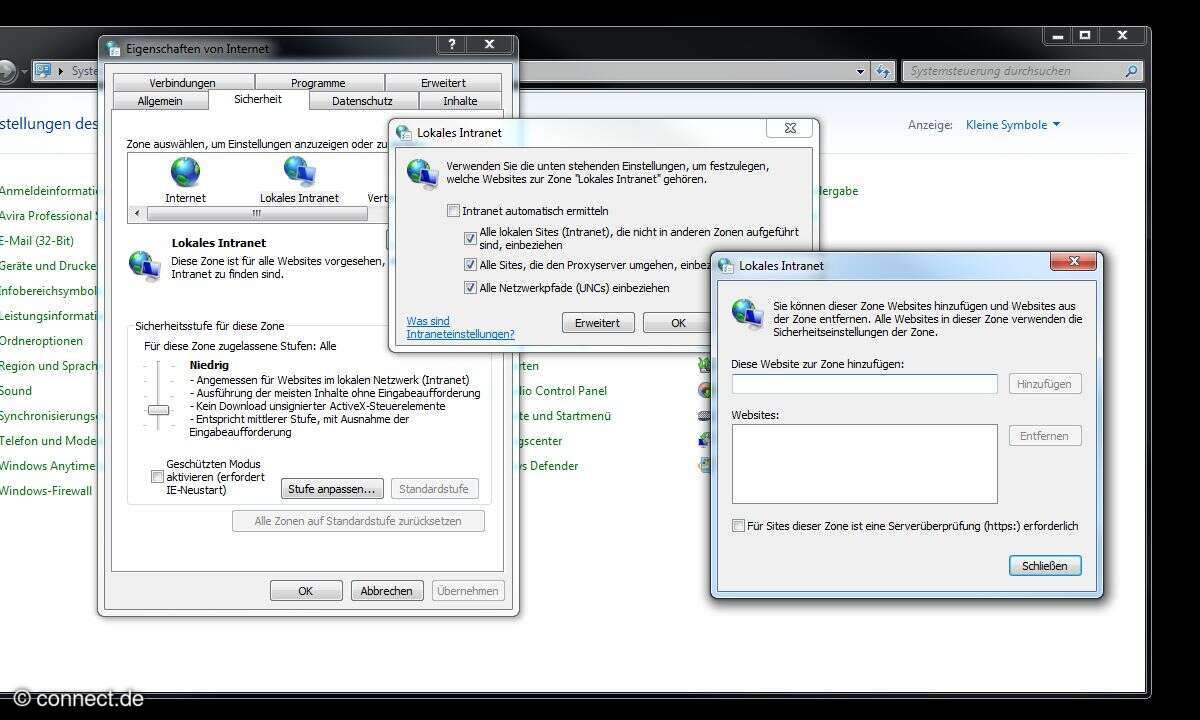Gigaset & Telekom: DECT-Telefone im Vergleich
Mehr zum Thema: Deutsche TelekomIm Festnetz wird immer weniger telefoniert. Dennoch gibt es nach wie vor interessante neue Geräte mit zusätzlichen Features fürs IP-Festnetz. Drei davon haben wir in unser verlagseigenes Testlabor geschickt.

Gerade unter jüngeren Nutzern sind Festnetztelefone meist out. Telefoniert wird ohnehin selten, und wenn überhaupt, dann mit dem Smartphone. Das gilt dann auch zu Hause. Allerdings: Wenn dort der Indoor-Mobilfunkempfang zu wünschen übrig lässt, wird die Tele-Plauderei zur Qual für beide Teilne...
Gerade unter jüngeren Nutzern sind Festnetztelefone meist out. Telefoniert wird ohnehin selten, und wenn überhaupt, dann mit dem Smartphone. Das gilt dann auch zu Hause. Allerdings: Wenn dort der Indoor-Mobilfunkempfang zu wünschen übrig lässt, wird die Tele-Plauderei zur Qual für beide Teilnehmer.
In solchen Fällen sollten auch Hardcore-Smartphone-Fans vielleicht ein Schnurlostelefon fürs (IP-)Festnetz in Erwägung ziehen – zumal die Telefoniefunktion beim zuhause obligatorischen Internetanschluss fast immer sowieso dabei ist.
Festnetztelefone vor allem bei älteren Nutzern populär
Eine deutlich treuere Klientel für die Hersteller von Festnetztelefonen sind ältere Nutzer. Sie haben die Unterscheidung zwischen heimischem und mobilem Telefon noch verinnerlicht und wissen die Vorteile der Zuhausetelefone zu schätzen – wie etwa die Zuverlässigkeit der Festnetzleitung und die oft bessere Sprachqualität der Geräte sowie die aufs Telefonieren optimierte Haptik und Bedienung.
Deshalb haben die Hersteller diese Klientel speziell im Blick – wie bei den hierangetretenen neuesten Modellen von Gigaset und der Telekom (insbesondere Speedphone 32). Schauen wir doch mal, wie sie sich im Praxis- und Labortest schlagen.
So testet connect
Um die Klangqualität und andere Eigenschaften von DECT-Telefonen zu messen, nutzt das verlagseigene Testlab ein Referenzsystem der Firma Head-Acoustics. Es dient für die Mobilteile als Basisstation und unterstützt dabei auch den Übertragungsstandard CAT-iq sowie Wideband-(HD-)Telefonie.
Die Klangqualität in Sende- und Empfangsrichtung wird an einem künstlichen Kopf in einer schalltoten Messkabine ermittelt. Dabei erfassen wir für den Betrieb am Ohr sowie im Freisprechmodus jeweils die Sprachqualität als TMOS-Wert (TOSQA Mean Opinion Score; TOSQA: Telecommunication Objective Speech Quality Assessment), außerdem die Verständlichkeit in einer simulierten Umgebung mit Bürohintergrundgeräuschen (3QUEST – 3-fold Quality Evaluation of Speech in Telecommunications).
In die Bewertung fließen auch die Lautheit des im Mobilteil eingebauten Lautsprechers und die Empfindlichkeit des Mikrofons ein, außerdem Übertragungsverzögerung, Kanalrauschen und Echo-Unterdrückung (TCLw – Terminal Coupling Loss weighted). Zudem messen wir den Stromverbrauch beim Telefonieren sowie im Standby-Betrieb. Aus den Messwerten und der Akkukapazität lassen sich dann die Betriebszeiten berechnen.