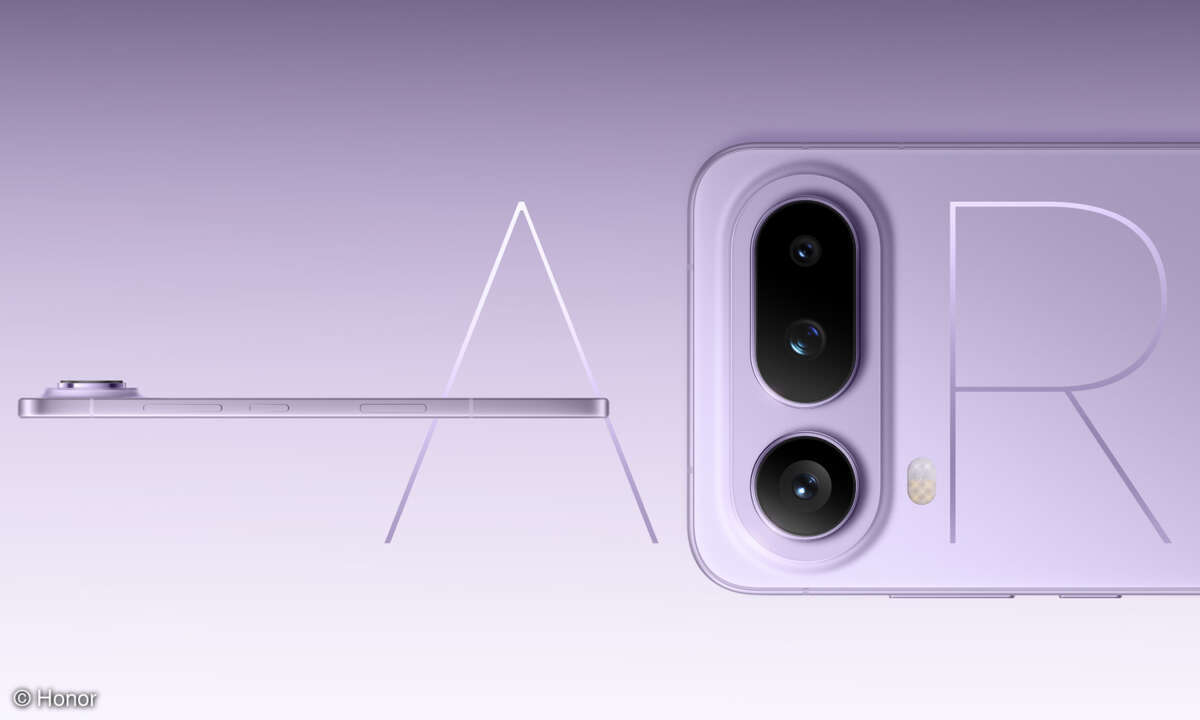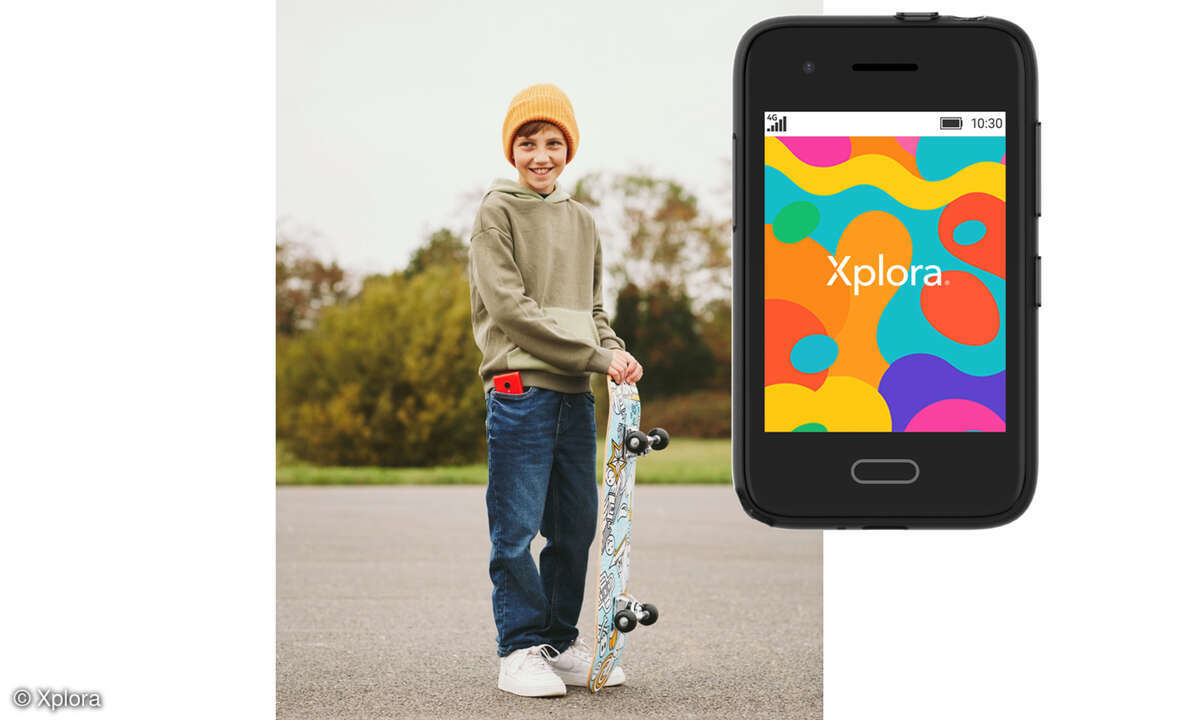So erkennt ein Smartphone jede Bewegung
Moderne Smartphones nehmen jede Bewegung durch ihren Nutzer wahr. Wir erklären, wie das technisch funktioniert.

Nicht immer sind Automatismen ein Segen: So raubte der Lagesensor im iPad anfangs so manchem Sofasurfer den letzten Nerv. Denn drehte man sich mit dem Tablet im Liegen auf die Seite, schaltete der Displayinhalt entsprechend ins Querformat um - an bequemes Lesen war nicht zu denken. Abhilfe schaffte ...
Nicht immer sind Automatismen ein Segen: So raubte der Lagesensor im iPad anfangs so manchem Sofasurfer den letzten Nerv. Denn drehte man sich mit dem Tablet im Liegen auf die Seite, schaltete der Displayinhalt entsprechend ins Querformat um - an bequemes Lesen war nicht zu denken. Abhilfe schaffte ein Update, dank dem man die Ausrichtung nun per Schalter fixieren kann. Doch wie erkennen Tablets und Smartphones, in welcher Lage sie benutzt werden und welche Sensoren machen sich Mobilgeräte sonst noch zunutze?

Möglichkeiten, die Bewegung eines Objektes zu erfassen gibt es viele. So wird beispielsweise bei Flugzeugen die Geschwindigkeit über den Druckunterschied zwischen der aus der Flugrichtung kommenden und der umgebenden Luft gemessen. Ziel ist es, in einem relativ zur Windgeschwindigkeit in Flugrichtung engen Speedbereich zu bleiben, um einen Strömungsabriss zu vermeiden, der zum Absturz führen würde.
Beschleunigungssensoren
Um ein Smartphone-Display situationsgerecht zwischenHoch- und Querformat umzuschalten, bedarf es im Prinzip nur zweier Sensoren. Die müssen die Beschleunigung in x- und y-Richtung des Displays messen. Dies sind die entscheidenden Messgrößen, weil die Schwerkraft der Erde die sogenannte Gravitationsbeschleunigung auf das Smartphone ausübt.

Davon kann sich jeder selbst überzeugen, indem er sein Smartphone einfach einmal loslässt. Je größer der Abstand zwischen der Hand des Nutzers und dem Punkt des Aufpralls, umso größer ist auch die Geschwindigkeit des Mobiltelefons beim Kontakt mit dem Boden; connect übernimmt für die Folgeschäden solcher Schwerkraftexperimente allerdings keine Haftung.
Um die Beschleunigung in einer Richtung messen zu können, reicht eine einfache Anordnung: Eine auf einem Stab in Messrichtung verschiebbare Masse ist an einer Feder aufgehängt. Je größer die Beschleunigung in die eine Richtung längs des Stabes ist, desto mehr wird die Masse aufgrund ihrer Trägheit in die andere Richtung ausgelenkt.
Bei zwei gleichen gefederten Massen, die auf den Achsen in x- und y-Richtung der Displayfläche beweglich aufgehängt sind, lässt sich nun leicht feststellen, welche Seite des Displays nach unten zeigt: Es ist die Richtung, in die die größte Auslenkung einer der beiden Massen erfolgt. Schwierigkeiten bekommt die Sensorik, wenn das Gerät etwa flach auf einem Tisch liegt, die Beschleunigung wirkt dann senkrecht zur Displayfläche, das wäre also die z-Richtung.
In der Regel haben moderne Smartphones Sensoren für alle drei Bewegungsrichtungen eingebaut. Denn aus der Kenntnis dieser Beschleunigungen lassen sich auch Beschleunigungen in jede beliebige andere Richtung berechnen.

Das kann auch an anderer Stelle sehr sinnvoll sein - etwa bei der Navigation, bei der lange Zeit fest eingebaute Navisysteme ihren mobilen Kontrahenten überlegen waren, weil sie den Fahrweg präzise über Radsensoren erfassen können. Diesen Nachteil haben Smartphones mittlerweile wettgemacht, denn über Beschleunigungssensoren lässt sich bei einmaliger Kenntnis der Geschwindigkeit ebenfalls der Fahrweg errechnen.
Beispiel: Fährt ein Auto mit per GPS gemessenen 50 km/h in einen Tunnel ein und beschleunigt dort auch wegen möglicher Radarfallen nicht, so hat es eine 400 Meter im Tunnel liegende Abzweigung nach knapp 30 Sekunden erreicht - denn 50 km/h entsprechen 833 Metern pro Minute. Über Sensoren gemessene Geschwindigkeitserhöhungen und Bremsmanöver lassen sich in solche Berechnungen einbeziehen, da die Wegstrecke mathematisch der doppelten Integration der Beschleunigung entspricht, zuzüglich der Konstanten, die über die als bekannt vorausgesetzte Anfangsgeschwindigkeit bestimmt werden kann. Autos greifen dabei heute auch auf die für elektronische Fahrassistenzsysteme wie ESP und Rollover-Sensing ohnehin vorhandenen Sensoren zurück. Besonders interessant sind diese auch in Smartphones für die Fußgängernavigation, da hier die begrenzte Genauigkeit von GPS allein besondere Probleme aufwirft.

Für Spiele wie das bei vielen HTC-Smartphones mitgelieferte Teeter, bei denen es gilt, eine virtuelle Kugel sicher durch ein mit Löchern versehenes Labyrinth ins Ziel zu steuern, ist ein Beschleunigungssensor natürlich ebenfalls wichtig. Hier ist die Messung der drei Raumachsen nötig, um Lage und Lageänderungen des Smartphones im Raum zu bestimmen.
Drehratensensoren
Doch neben der Beschleunigung gibt es noch eine andere Bewegungsart, für die moderne Smartphones zunehmend Sensoren bekommen: die Rotation. Auch rotieren kann ein Mobiltelefon um drei voneinander unabhängige Achsen. Dabei lässt sich jede beliebige Drehbewegung als Kombination aus denen um die drei Hauptachsen zusammensetzen. Mit den drei Bewegungsrichtungen entlang einer Linie ergeben sich so sechs sogenannte Freiheitsgrade.
Ein Drehbewegungssensor kann mit einer Stimmgabel (Bild links) veranschaulicht werden. Ihre beiden Zinken schwingen nach dem Anschlagen gegensinnig aufeinander zu und voneinander (V) weg. Dreht sich die Gabel dabei um ihre Längsachse (\xce\xa9), so findet gleichzeitig eine Ablenkung der schwingenden Zinken entgegen der Drehrichtung (S) statt. Über die Messung der Ablenkung lässt sich die sogenannte Drehrate bestimmen.
In der Praxis sind drei Schwinggabeln natürlich meist zu groß. Firmen wie der für spezialisierte Kraftfahrzeugtechnik bekannte Hersteller Bosch greifen deshalb etwa für ESP-Systeme auf Strukturen zurück, von denen eine oben links auf dieser Seite abgebildet ist. Die Bezeichnungen für Schwingungsrichtung V, Sensierrichtung S und Drehrate \xce\xa9 sind hier analog zur Stimmgabel markiert.

Doch die "schwingenden Massen" ersetzen die Zinken der Stimmgabel, die flachgehaltenen, U-förmigen Federn stehen für die Schultern. Zum Schwingen in Richtung V auf ihrer primären Resonanzfrequenz angeregt werden die beiden Massen durch sinusförmige Spannungen (plus einer Gleichspannung) an den beiden inneren Kammstrukturen. Dass die Federn in Schwingungsrichtung V weniger steif sind als in Sensierrichtung, trägt dazu bei, dass die durch Drehung (\xce\xa9) resultierende sekundäre Schwingung in Richtung S auf einer anderen Frequenz erfolgt als die der Anregung. Das macht das Detektieren von Drehbewegungen einfacher. Bei geeigneter Auslegung ist die Amplitude der sekundären Schwingung beinahe linear zur Drehrate, wir haben also einen fast optimalen Drehratensensor.
Microelectromechanical Systems
Natürlich entscheidet auch der Preis über den Einsatz von Sensoren bei Smartphones. Letztendlich darf keine Komponente ein Mobiltelefon unangemessen verteuern, zudem gibt es Restriktionen bei der Größe. Beide Anforderungen sprechen für die bei sogenannten Microelectromechanical Systems (MEMS) angewandte Herstellungsweise.

Die Fertigung orientiert sich dabei an der von Prozessoren, Speichern und anderen integrierten Schaltungen bekannten Bauweise. Als Materialien kommen Halbleiter, Metall, aber auch Kunststoff und Keramik zum Einsatz. Diese werden in extrem dünnen Schichten von wenigen milliardstel bis zu einem zehntausendstel Meter erzeugt und dann in lithografischen Prozessen bearbeitet. Dazu kommt auf das Grundmaterial eine strahlungsempfindliche Schicht.
Dann wird entsprechend der gewünschten Struktur belichtet, entwickelt und zur endgültigen Form geätzt. Je nach Anforderung besteht ein fertiger MEMS-Baustein aus mehreren Schichten, er kann neben mechanischen Elementen auch elektronische Schaltungen enthalten. Das ist nicht günstig: Experten beziffern die Preise zwischen einem und fünf Dollar pro Bauteil für die in großen Stückzahlen gehandelten Komponenten.