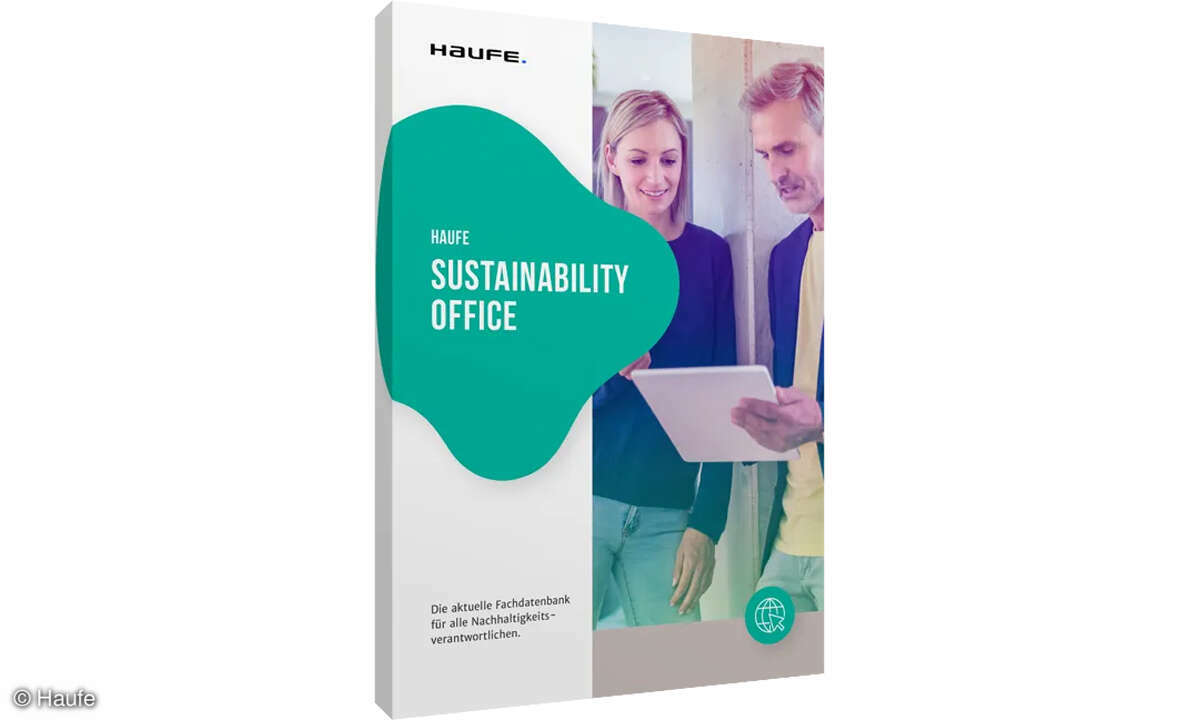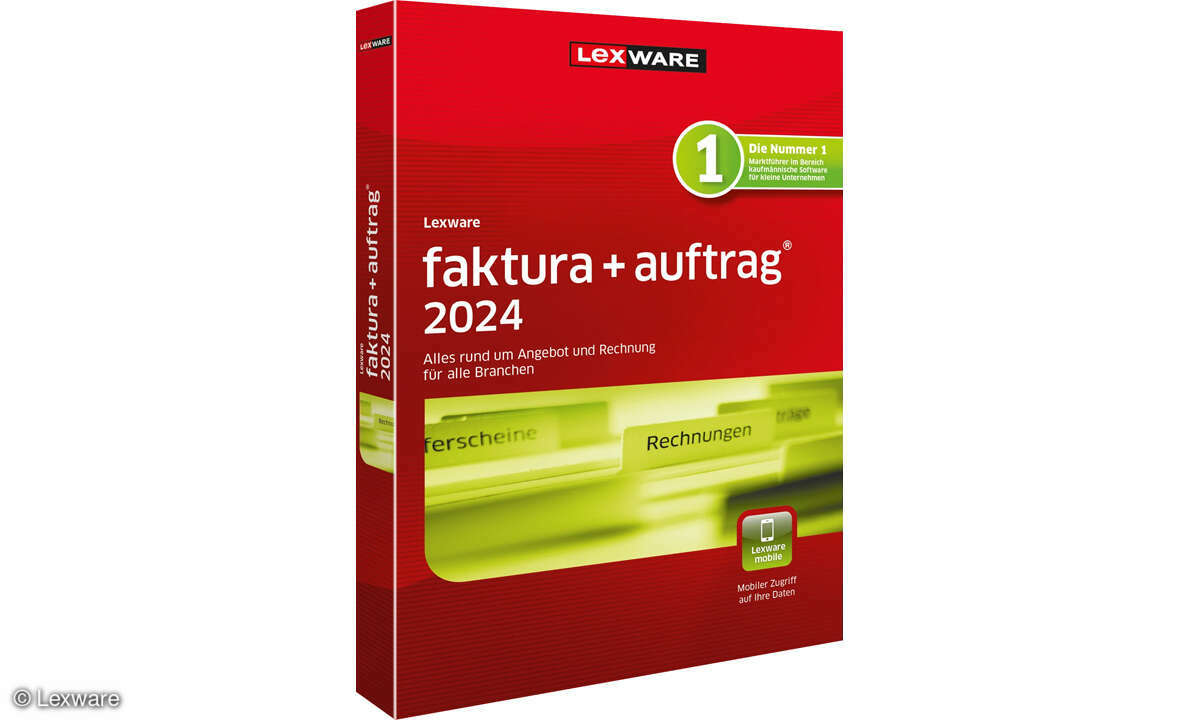Endverstärker Octave MRE 220 im Test
Die neuen Monos von Octave können fantastisch verstärken. Im Test zeigen sie eindrucksvoll, was mit Röhren-Technik derzeit möglich ist.

Octave MRE 220: Technik Das Intro der Anleitung, verlangt dem Leser eine Portion Sachverstand ab. Auf diesen Seiten erklärt die Firma aus Karlsbad im Nordschwarzwald, wie sich durch galvanische Verkopplung Brummschleifen einschleichen, wie sich diese Unbill vermeiden lässt und warum in den Eing�...

Octave MRE 220: Technik
Das Intro der Anleitung, verlangt dem Leser eine Portion Sachverstand ab. Auf diesen Seiten erklärt die Firma aus Karlsbad im Nordschwarzwald, wie sich durch galvanische Verkopplung Brummschleifen einschleichen, wie sich diese Unbill vermeiden lässt und warum in den Eingängen der MR 220 hochsymmetrische Instrumentationsverstärker des Typs INA134 zum Einsatz kommen, deren Minus-Anschluss bei koaxialer Ansteuerung nicht direkt, sondern via 22-Ohm-Widerstand an Gehäusemasse liegt.

Wem beim Zweibein-XLR-Anschluss die bereits sehr hohe Gleichtaktunterdrückung der Studio-ICs nicht reicht, darf die MRE 220 statt für 16.500 für 17.000 Euro bestellen. Ein kleiner Octave-Eingangsübertrager erhöht die galvanische Trennung auf quasi unendlich und den Abstand zu potenziellen Einstreustörungen breitbandig auf über 80 Dezibel. Sapperlot, dass man so ausgefuchst wickeln kann. Der Techniker verneigt sich und murmelt etwas von Weltrekord.
Damit nicht genug. Denn am anderen Ende des Verstärkers arbeitet ein physisch wie technisch noch größeres Trafo-Wunderwerk. Nicht nur, dass Octave sich wohl als einziger Hersteller die sauguten und sauteuren Schweizer Übertrager-Eisenbleche mit Philbert-Schnitt und die damit verbundene Mühsal des Zurechtbiegens leistet (während ein EI-Kern einfach zusammengeschoben wird). Es musste diesmal auch eine neue Wickeltechnik sein. Und zwar eine, bei der nur die halbe Lage des Wickels einen Draht bestimmter Stärke bekommt und die andere Hälfte einen anderen. Schicht für Schicht entsteht so ein quasi über kreuz verschachtelter Trafo, der mit einer um Größenordnungen besseren Symmetrie aufwarten kann. "Hmm", darf Octave-Chef Andreas Hofmann da spitzbübisch grinsen: "Wir brauchen das, weil man nur mit höherer Symmetrie bessere Gegentaktverstärker bauen kann."

Das Prinzip des Doppelnetzteils, das die Hochspannung extra sicher in zwei Hälften aufbereitet und mit Siemens-Epcos-Elkos speichert, kennen stereoplay-Leser von anderen Octave-Modellen. Die 6SN7 im Eingang der MR 220, die zweistufige Treiberanordnung mit Gegentaktpendant und gleich vier KT 120 im Ausgang: Die weitere Bestückung deutet auf Qualität hin - wie auf Nachschub.
Octave MRE 220: Klang
Und was für ein Klang! Das Messlabor ermittelte einen für Röhrenverstärker sensationellen Wert von 170 Watt pro Block. Und ein bei verschiedensten Frequenzen und Lasten wunderbar konstant harmonisches - noch viel sensationelleres - Klirrverhalten. Vorausgesetzt, die erste und die zweite Oberwelle stören nicht, zeigen die Messungen, dass ein MR 220 sauberer als ein Transistor-Amp agiert!
Der stereoplay-Logistikchef Kristian Rimar täuschte sich nicht, als er die Octaves in der Kette mit der AVM PA 8 (zum Test) und den Sonics Allegra sogar sauberer als die MX-R von Ayre wahrnahm. Den Einwand, dass die Transistor-Referenzmonos um ein Fitzelchen feiner zeichnen, mochte er nicht gelten lassen. Recht so: Die Amerikaner diversifizierten zwar Hintergrundgeigen auch örtlich besser, doch die MR 220 konterten mit mehr Klangsubstanz bei den Instrumenten: mit einer rosshaarigeren Widerspenstigkeit beim Anstrich, mit mehr Korpus, mehr Firnis und mehr Luftigkeit. Die Halbleiterei flutschte dagegen scheinbar über einiges hinweg, so als wäre zu viel Öl in ihr Getriebe gekommen.
Üblicherweise kommt nun der Knackbass als Pro-Transistor-Argument. In diesem Falle schwierig. Denn die MR 220 hielten dagegen: mit einem Bass, der sich in Farbe, Gestalt und Elan wohl kaum übertreffen lässt.