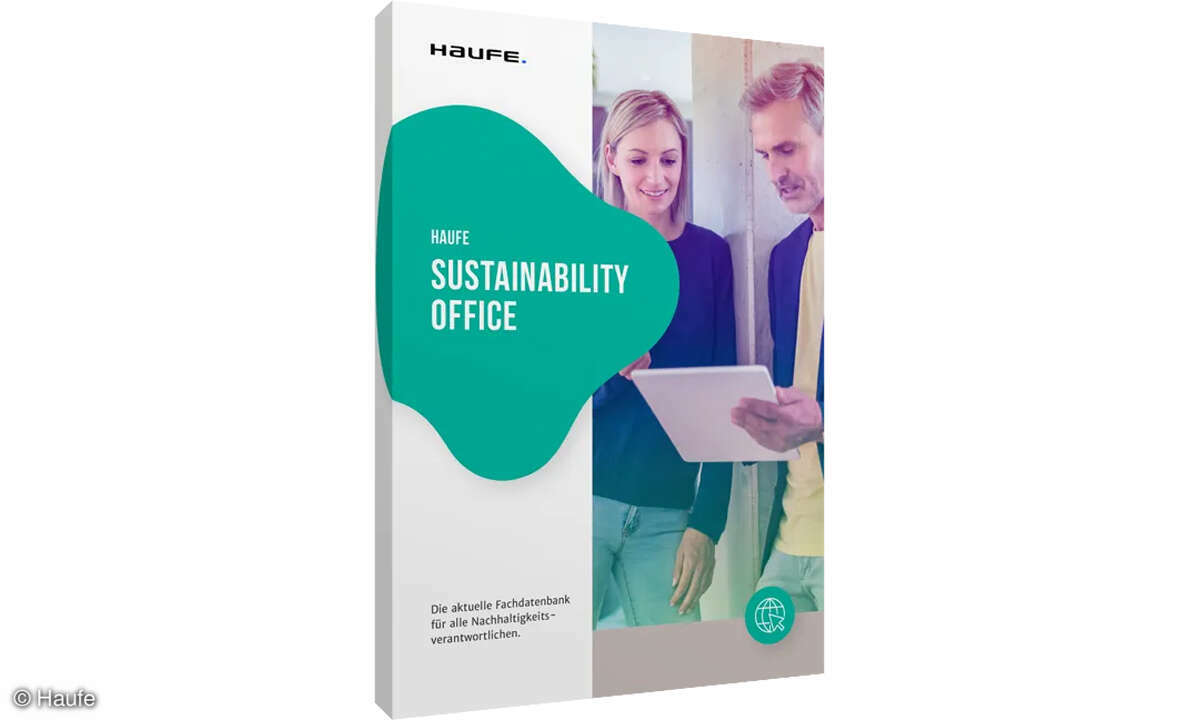Rundstrahlverhalten bei Lautsprechern
Die Energie im Raum

Schalldruckkurven, wie stereoplay sie regelmäßig in den Messwertetabellen abdruckt, verraten eine Menge über eine Box, aber beileibe nicht alles, denn sie erfassen nur einen schmalen Raumwinkel....
Schalldruckkurven, wie stereoplay sie regelmäßig in den Messwertetabellen abdruckt, verraten eine Menge über eine Box, aber beileibe nicht alles, denn sie erfassen nur einen schmalen Raumwinkel.

Die wichtigste Bezugsgröße ist die Hauptachse, die man sich als gedachte Linie senkrecht zur Schallwand vorstellen kann. Ihre Höhe ist bei Standboxen 1 Meter über dem Fußboden (der Ohrhöhe eines sitzenden Hörers), bei Kompaktboxen vorm Hochtöner, da die Einsatzhöhe anwenderabhängig ist. Weitere Messungen erfolgen 10 Grad oberhalb dieser Achse (in der Standardmessung grün dargestellt) sowie 30 Grad seitlich (blau).

Tatsächlich erfolgt die Abstrahlung deutlich breiter, im Bass nahezu kugelförmig. Über Raumreflexionen gelangt auch diese Energie ans Ohr, wenn auch in abgeschwächter Form. Das Dilemma: Tonal ausgewogen klingende Boxen mit gleichmäßiger Energieverteilung über einen sehr breiten Winkelbereich messen sich axial nicht zwangsläufig linealglatt.

Grundsätzlich gilt: Je höher die Frequenz und je kürzer die Wellenlänge in Relation zur schwingenden Fläche, desto stärker die Bündelung. Bemerkbar macht sich das vor allem beim Übergang zwischen Mittel- und Hochtöner, der in der Regel zwischen 2 und 5 Kilohertz stattfindet. Große Mitteltöner zeigen dort eine starke Richtwirkung, während der sehr viel kleinere Hochtöner dieselben Wellenlängen erheblich breiter abstrahlt. Die Folge sind Einschnürungen in der räumlichen Verteilung.

Boxen mit zwei Mitteltönern verhalten sich in der Vertikalen wie eine große Einzelschallquelle mit starker Bündelung in der senkrechten. Boden und Decke erhalten weniger Energie, der Direktschallanteil am Hörplatz ist größer, der Klangeindruck trockener.
Die Messungen zeigen die räumliche Verteilung der Energie. Sie verdeutlichen, warum Boxen mit ähnlichen (axialen) Schalldruckkurven so unterschiedlich klingen können.