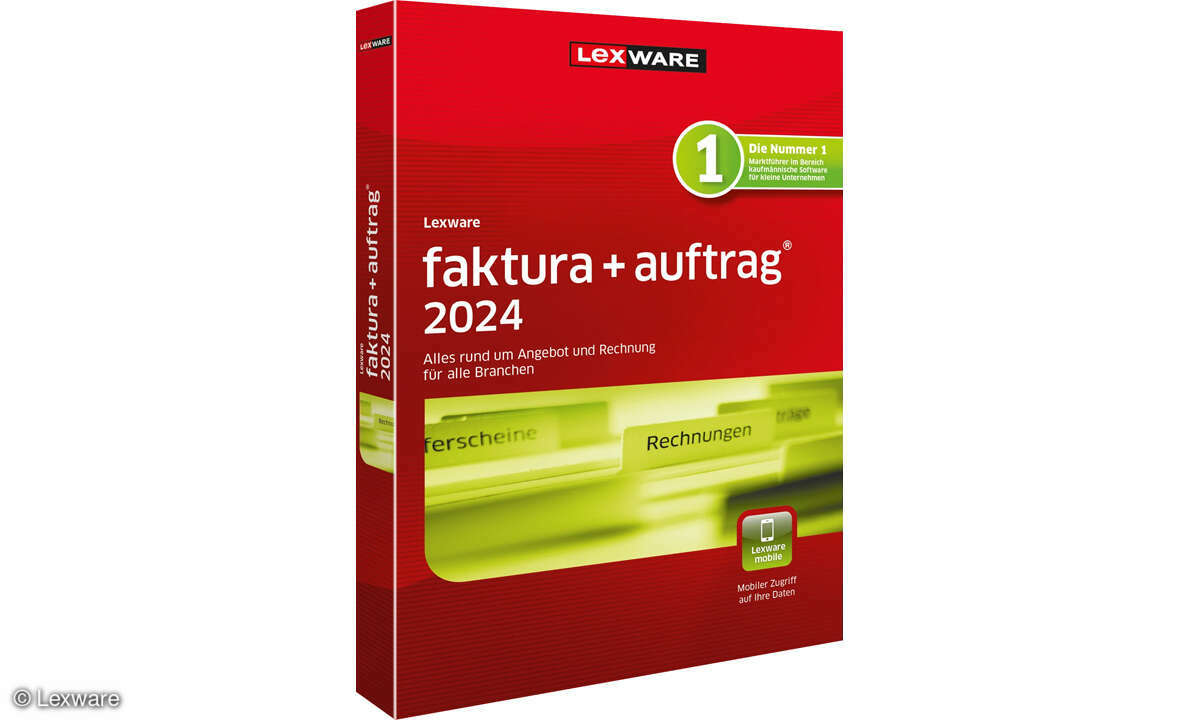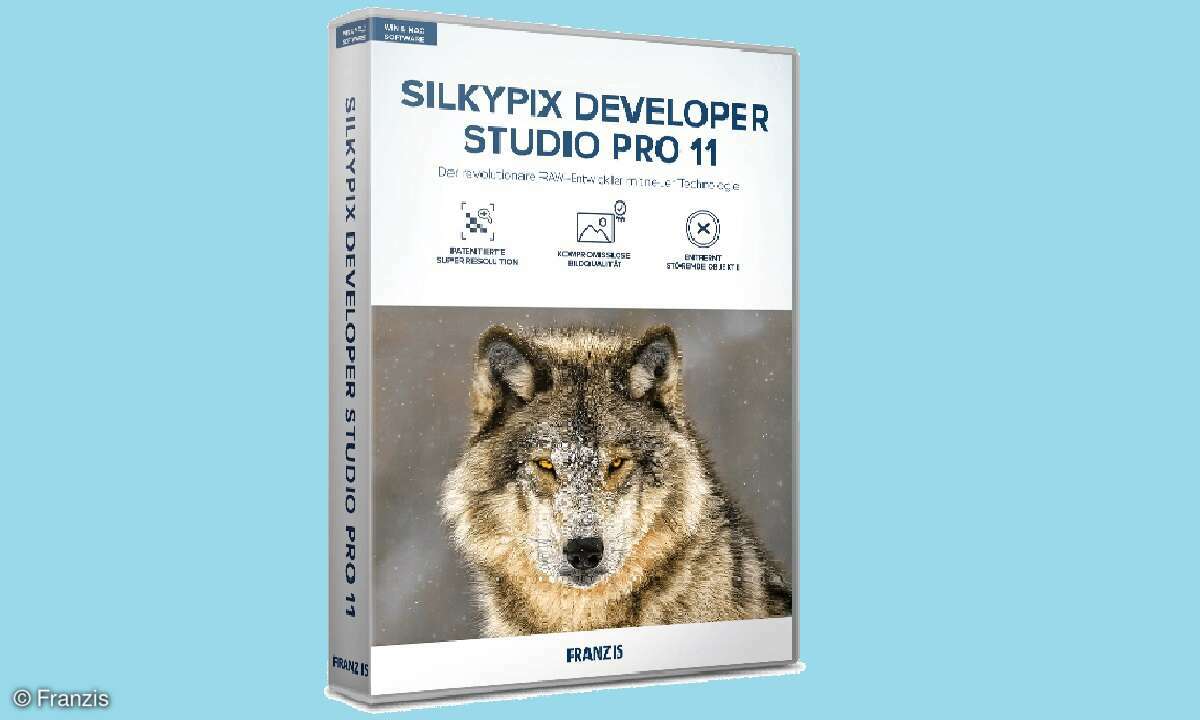Vollverstärker Brinkmann Der Vollverstärker
Der Vollverstärker von Brinkmann (5500 Euro) tönte schon bei den ersten Takten Musik fantastisch: warm, tragend und fein. Bei den weiteren erschien er bereits traumhaft, und bei den nachfolgenden zog er die Hörer in eine Art Zeitmaschine hinein.

- Vollverstärker Brinkmann Der Vollverstärker
- Datenblatt
"Einfach nur dem schönen Schein", beantwortet Helmut Brinkmann die Frage, wozu die beiden strahlenden Leuchtdioden hinten in seinem Vollverstärker dienen. Doch nur ein ganz grüner HiFi-Novize könnte der Idee verfallen, der Entwickler habe den 5500-Euro-Amp durch und durch auf Show getrimmt. De...
"Einfach nur dem schönen Schein", beantwortet Helmut Brinkmann die Frage, wozu die beiden strahlenden Leuchtdioden hinten in seinem Vollverstärker dienen. Doch nur ein ganz grüner HiFi-Novize könnte der Idee verfallen, der Entwickler habe den 5500-Euro-Amp durch und durch auf Show getrimmt.
Der alterfahrene HiFiist weiß sofort, dass Brinkmann deswegen einen Gehäusedeckel aus Glas nimmt, weil es in einem blechernen zu magnetischen Wirbeln kommt, die auf die Schaltung zurückwirken könnten. Und umso lieber schaut er jetzt durch das Fenster hindurch, um eine Art Lehrpfad des highendigen Verstärkerbaus zu entdecken. Ja, genau so müssen die Cinchbuchsen festverschraubt und dann inklusive Mutter und Gewinde gut verlötet auf einer Platine sitzen, die sich mit ihrer isolierten Seite an die Rückwand presst.

Die von 35 auf rund 100 Mikrometer aufgedickten Leiterbahnen des Boards, in dem die heißen Anschlussstifte münden, winden sich subito dem Eingangswähler zu - wie nicht anders zu erwarten zu einem Drehschalter des Schweizer Herstellers Elma, bei dem dank Material und Federkraft die Gewähr besteht, dass er bei jeder Betätigung seine Kontakte gründlich reinigt.
Von dort aus geht es schnurstracks zum Motor-Lautstärkepotentiometer und von da aus auch schon zu den ganz links und rechts angeordneten Endstufen. Womit klar wird, dass der Vollverstärker eingangsseitig passiv arbeitet und dass Brinkmann im Zeitalter sprudelnder Hochpegelquellen von aktiven Pufferkreisen und dergleichen nichts hält.
Dafür arbeitet seine "Restelektronik" - allein schon damit über den Schleifer und die Kohlebahn des Potentiometers keine größeren klangverschlechternden Ströme fließen müssen - mit höchster Eingangsempfindlichkeit und mit außergewöhnlicher Präzision. Um diese zu gewährleisten, setzte Brinkmann eine Schaltung (in der Techniker einen Doppeldifferenzverstärker mit Hilfs-Stromquellen erkennen) auf eine kleine Extraplatine, die durch einen Laserabgleich der Auflöt-Metallfilmwiderstände auf Bestform getrimmt werden kann.

Zunächst darf auch eine energische Gegenkopplungsschleife helfen, die eine weitere Spannungsverstärker- und die Treiberstufe mit einschließt. Aber nicht die Endstufe, die mit einem Pärchen Sanken-Transistoren arbeitet. Bei den Typen suchte Brinkmann solche aus, die ohne die sonst üblichen Keramik-Emitterwiderstände auskommen.
Der Verzicht auf die Rückkorrektur erfordert nicht nur den extra sauberen Aufbau, sondern eine äußerst reine und magnetisch nicht sauigelnde Stromversorgung. Weshalb es im Vollverstärker einen Ringkerntrafo mit Mu-Metall-Abschirmhaube (magnetisch undurchlässig) zu bewundern gibt, den ein zentimeterdicker Messing-Deckel laut Brinkmann zur klanglichen Balance zwingt. Und vier 15_000-Mikrofarad-Elkos, für die es keine krönendere Begrifflichkeit als den gold-feingezeichneten Aufdruck gibt: Epcos Sikorel 105.
Ob ihnen die von Brinkmann eingebrachte Längsbohrung der Pluspol-Befestigungsschrauben wirklich zum letzten Schliff verhilft oder nicht, der Vollverstärker tönte schon bei den ersten Takten Musik fantastisch: warm, tragend und fein. Bei den weiteren erschien er bereits traumhaft, und bei den nachfolgenden zog er - was nur bei ganz wenigen Verstärkern so zwingend passiert - die Hörer in eine Art Zeitmaschine hinein. Und zwar im doppelten Sinne: Erstens, weil wie beim Test geschehen, beim Musikhören mit dem Brinkmann wie im Fluge viele, viele Stunden vergehen. Und zweitens, weil er das in der Vergangenheit liegende musikalische Ereignis mit abenteuerlicher, Rückenschauer auslösender Echtheit reanimieren kann.

Zum Beispiel den Bass bei "Besame Mucho" von stereoplays "Ultimate Tunes"-SACD. Völlig gelöst, ohne die geringste Qualligkeit und ohne sinnlose Schwere untenrum und oben ohne die geringste Härtlichkeit schwingen die dicken und dünneren Saiten dahin. Erst bei dieser Sauberkeit vermitteln sie nicht nur die tragende Arbeit, sondern die feinsten Regungen des Bassisten. Etwa wie er sich dem Saxophon-Solo erst dienend fügt, dann trotzig ein wenig daran reibt, um schließlich - während der Bläser sich fast überschlägt - selbst aufzubegehren und Emotionen loszulassen.
Analog geschieht es bei den wirbelnden Stöcken, die mal mit etwas mehr, mal mit weniger Verve weiter innen oder außen auf die Snaredrum platzen oder auf die Becken, die mal verhaltender, mal triumphierender sprühen.
Und glühten die Vibraphon-Platten nur so vor Begeisterung, bemühte sich der Vollverstärker nicht zuletzt mit Linda Sharrocks natürlicher Stimme nicht um irgendeinen Selbstzweck, sondern einfach nur darum, den seelischen Schluss herzustellen und zu zeigen, da steckt unendlich viel Herzblut drin.
Herzblut hat auch Helmut Brinkmann 20 Jahre lang in die Vollendung des Vollverstärkers gesteckt - bei diesem Ergebnis lohnte sich die Arbeit !
Brinkmann Der Vollverstärker
| Brinkmann Der Vollverstärker | |
|---|---|
| Brinkmann Der Vollverstärker | |
| Hersteller | Brinkmann |
| Preis | 5500.00 € |
| Wertung | 57.0 Punkte |
| Testverfahren | 1.0 |