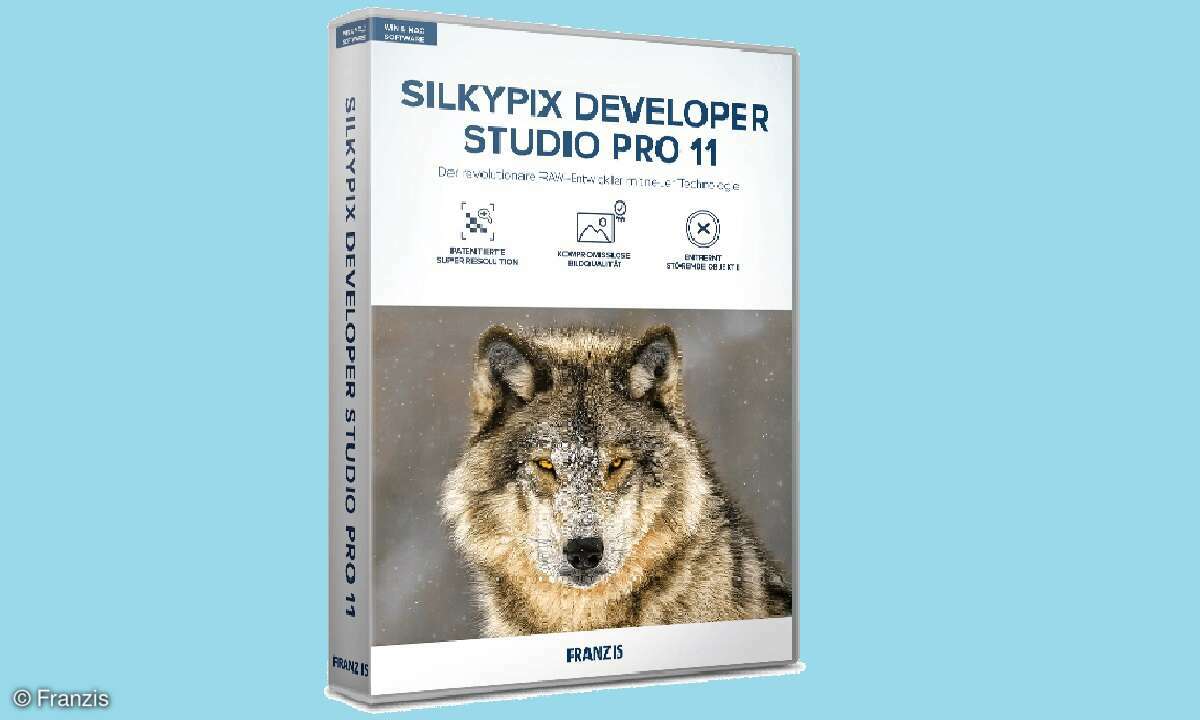Einstecken und Auflegen - Rega RP1 (350 Euro) im Test
Spielfertig vormontiert, macht der Rega RP-1 schon fünf Minuten nach dem Öffnen des Kartons Musik. Und, da ist sich AUDIO sicher, fünf Jahre später immer noch. Nachhaltiger als in den neuen Einsteiger-Plattenspieler aus Essex lassen sich 350 HiFi-Euro zur Zeit nicht versenken.

- Einstecken und Auflegen - Rega RP1 (350 Euro) im Test
- Datenblatt
Jahrzehntelang markierte der Rega Planar 2 - und später sein direkter Nachfolger P2 - den Einstieg in das Plattenspieler-Programm des englischen Herstellers. Das änderte sich erst vor etwa fünf Jahren, als die unaufhaltsame Preisspirale, die gerade bei solchen in kleinen Stückzahlen handgemachte...

Jahrzehntelang markierte der Rega Planar 2 - und später sein direkter Nachfolger P2 - den Einstieg in das Plattenspieler-Programm des englischen Herstellers. Das änderte sich erst vor etwa fünf Jahren, als die unaufhaltsame Preisspirale, die gerade bei solchen in kleinen Stückzahlen handgemachten Produkten besonders gut greift, den Rega P2 endgültig aus der Reichweite typischer Einsteiger-Budgets herausgeschraubt hatte. Die Lücke ganz unten im Modellprogramm füllte der P1 (AUDIO 8/07), Regas erster Beitrag zu jener Spielergattung, die irgendwann das Etikett "Plug&Play" angehängt bekam: ein fix und fertig vormontiertes Laufwerk also, das selbst degenerierte Digital-Grobiane, die bei "Anti-Skating" an Sport denken, problemlos zum Laufen bringen könnten.

Der Rega P1 kam dem utopischen Ziel immerhin nahe, bot aber auch Raum für weitere Entwicklungen. So wurde der neue Rega RP-1 in fast jedem Detail gegenüber dem Vorgänger verändert. Aus dem Tonarm RB-100 wurde der RB-101 mit soliderem Lagerblock und detaillierter ausgeformtem Headshell, das nun - wie die größeren Rega-Arme - versenkte Langlöcher hat. Was die Tonabnehmermontage ungemein erleichtert, weil man die Muttern nicht mehr gegenhalten muss und das System beim Festziehen nicht mehr verrutscht.

Das vorderste Loch in der Headshell erfüllt gleich zwei Funktionen: Es ersetzt einerseits die Justage-Schablone, weil es so gesetzt ist, dass die Nadelspitze bei korrektem Überhang genau mit seiner Vorderkante fluchtet. Andererseits kommt hier bei Systemen mit Dreipunkt-Befestigung, etwa dem Rega Exact, die dritte Schraube durch.
Beim Rega RP1 ist zunächst mal beides unwichtig, da der Tonabnehmer ja schon montiert und justiert ist - wie beim Vorgänger das millionenfach bewährte MM-System Ortofon OM-5E. Dessen Auflagekraft wird nach dem Auspacken des Spielers auf denkbar simple Weise eingestellt: Man steckt das Gegengewicht einfach bis zum Anschlag auf den Arm-Ausleger, dann resultieren die benötigten 1,7-1,8 Gramm von selbst. Unpraktischer als der RB-100 ist der Rega RB-101 allerdings, wenn später mal ein anderes System montiert werden soll: Der alte Arm führte das Gegengewicht auf einem Gewinde mit definierter Steigung, bei der jede halbe Umdrehung einem Gramm Differenz entsprach. Damit ließ sich das Gewicht nach vorherigem Ausbalancieren auch ohne Tonarmwaage einstellen. Letztere ist beim 101 zwingend nötig, um ein neues System korrekt einzustellen. Wobei es kein ultragenaues Neurotiker-Tool sein muss - die klassische, billige Ortofon-Schaukel reicht, denn die Feinarbeit macht man eh nach Gehör.
Die zweite wichtige Änderung betrifft den Teller. Der P1 trug aus Kostengründen einen MDF-Teller, den Rega vorher schon bei OEM-Modellen für Moth und NAD eingesetzt hatte. Firmenchef und Ingenieur Roy Gandy, dem der Holzwerkstoff wegen seiner eher geringen, zudem nicht hundertprozentig gleichmäßigen Dichte wohl eher suspekt war, suchte Alternativen und fand - Bakelit. Den schwarzen Pressling aus dem ältesten aller Kunststoffe als Plastikteller zu bezeichnen, grenzt schon an Majestätsbeleidigung. Das auf Phenolharz basierende Material ist für einen Kunststoff sehr hart, extrem haltbar und formstabil, lässt sich sehr präzise fertigen - und hat trotzdem eine wunderbar weiche, glatte Haptik. Was der Besitzer spätestens beim Drehzahlwechsel merkt, wenn es heißt: Teller runter, Riemen umlegen.
Drehzahlwechsel sind auch der einzige Grund, den Spieler je abzuschalten. Rega selbst empfiehlt sein jeher, den Teller während einer Hörsession durchlaufen zu lassen - der fliegende Plattentausch funktioniert mit dem kurzen Mitteldorn und der weichen Filzmatte völlig problemlos. Einen neuen RP1 kann man zumindest während der ersten Wochen ruhig Tag und Nacht laufen lassen: 1,4 Watt Stromverbrauch stehen dabei einer koninuierlichen Zunahme an Laufruhe und Geschmeidigkeit gegenüber.

Selbst nach üppiger Einspielzeit konnte der Test-RP1 aber einen Hauch von Motorgeräusch im Ausgangssignal nicht verbergen. Das ist schon der einzige Kritikpunkt am RP1 - der an anderen Spielern in dieser Preisklasse zudem noch deutlicher auftritt. Musik klingt über den RP-1 wunderbar straff und griffig, subjetiv lauter als über den mit gleichem System bestückten P1 - ein untrügliches Zeichen für geringere Verluste im Abtastvorgang. Vergleicht man den Rega RP1 mit größeren Spielern, erkennt man ihn an seinem zurückhaltenden Tiefbass und - am anderen Frequenzextrem - seinem etwas diffuser aufgelösten Obertonbereich. Dazwischen, vor allem in den wichtigen Mittellagen,

herrscht Rega-Klang in Reinkultur: Statt um jeden Preis das Soundkostüm der Musik mit seinen ganzen Falten, Rüschen und Pailetten nachzeichnen zu wollen - um sich dann wie viele erschwingliche Spieler hoffnungslos zu verfranzen - musiziert der RP1 mit einer geheimnisvollen Ökonomie. Rhythmus, Tempo, Betonung und Phrasierung scheinen Vorfahrt zu genießen vor Bling-Bling und anderen audiophilen Schlüsselreizen - gut so.
Fazit
Rega hat jüngst die Garantiezeit für alle Plattenspieler auf zehn Jahre erhöht. Bis sie abläuft, wird man mit dem RP1 etliche Nadeln verschlissen haben. Den Spaß am Vinyl-Hören wird man aber nicht verlieren - garantiert.
Rega RP-1
| Rega RP-1 | |
|---|---|
| Rega RP-1 | |
| Hersteller | Rega |
| Preis | 350.00 € |
| Wertung | 75.0 Punkte |
| Testverfahren | 1.0 |