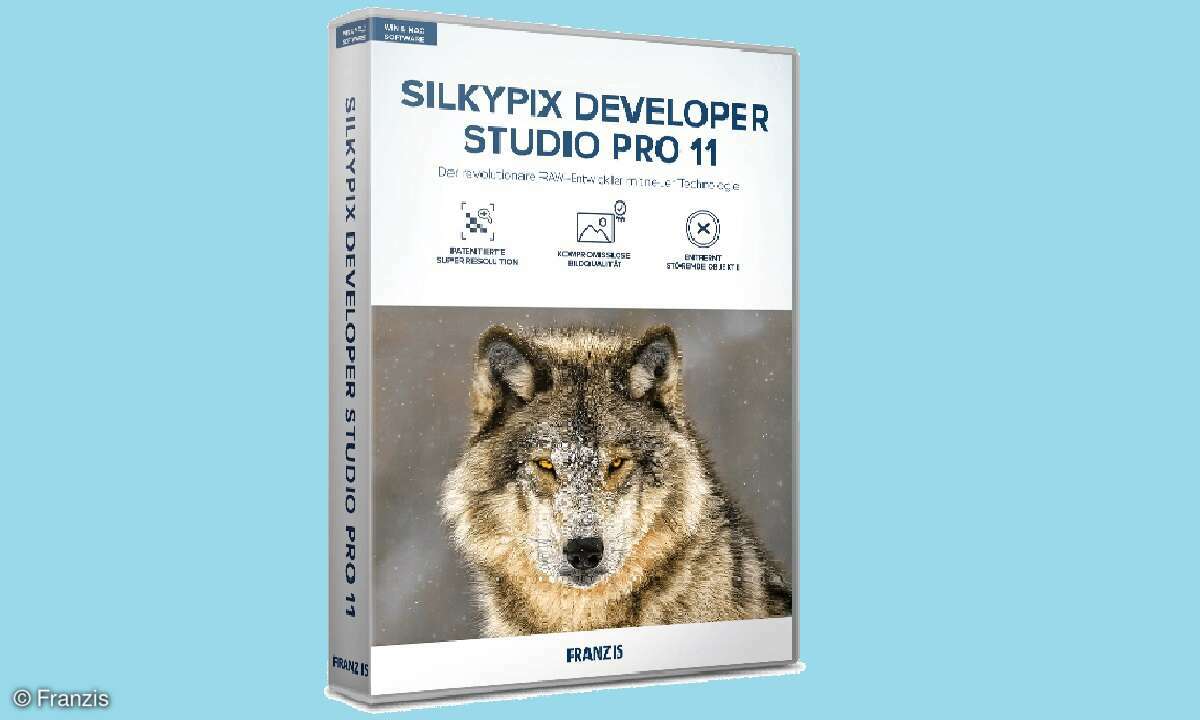KEF Reference 3 im Test
Bei der äußeren Gestaltung zeigt sich die Reference 3 von KEF vergleichsweise zurückhaltend. Doch unter der zeitlosen Hülle steckt einer der leistungsfähigsten Punktstrahler aller Zeiten. In diesem Treiber wie auch in den übrigen Komponenten der Standbox stecken mehr als 30 Erfahrung.

Einige Szene-Enthusiasten betrachten Lautsprecher als eine der letzten "handwerklich-analogen" Bastionen, dominiert von traditioneller Elektromechanik und Materialkunde. Die gleichen Personen reagieren ausgesprochen skeptisch, wenn sie erfahren, dass Hersteller wie KEF seit über 30 Jahren koaxiale ...
Einige Szene-Enthusiasten betrachten Lautsprecher als eine der letzten "handwerklich-analogen" Bastionen, dominiert von traditioneller Elektromechanik und Materialkunde. Die gleichen Personen reagieren ausgesprochen skeptisch, wenn sie erfahren, dass Hersteller wie KEF seit über 30 Jahren koaxiale Zweiwegesysteme erforschen und mit schöner Regelmäßigkeit neue Klangfortschritte verkünden, basierend auf modernsten, computergestützten Entwicklungsmethoden.
Ein knapp 30-seitiges White Paper, das auf der KEF-Homepage zum Download bereit steht, offenbart einen ausgeprägten Hang zu ganzheitlichen Lösungen und akustischer Perfektion, den sich die britische Traditionsfirma selbst verordnet hat. Teilweise sind die Einblicke so umfassend, dass man sie beinahe als Bauanleitung verwenden könnte. Doch einfaches Copy-and-Paste funktioniert in diesem Falle nicht, auch weil zahlreiche Detaillösungen patentiert sind.
Aufbau
Gewaltige sechs Oktaven soll das streng koaxial aufgebaute Zweiwegesystem hochgradig signaltreu verarbeiten. Der einzige Frequenzbereich, den der knapp 13 Zentimeter große Stolz der Firma nicht mit highend-kompatiblen Pegeln darbieten kann, sind die besonders langwelligen Lagen unter 350 Hz. Deshalb stecken in den meisten KEF-Boxen zusätzliche, konventionelle Konus-Chassis. In der Reference 3 schuften gleich zwei Tieftöner mit hochfesten Alumembranen, die den Uni-Q in ihre Mitte nehmen.
Puristen könnten in diesem Zusammenhang darauf verweisen, dass auch Breitbandysteme, die aus deutlich weniger Einzelteilen bestehen, dem Ideal einer punktförmigen Schallquelle sehr nahe kommen. Bei diesen Treibern handelt es sich vielfach um modifizierte Tief- und Mitteltöner mit leichteren Membranen und geringerer, mechanischer Dämpfung. Physikalisch bedingt können kolbenförmig schwingende Membranen allerdings nur zwei bis drei Oktaven wirklich frequenzlinear verarbeiten, keinesfalls aber das gesamte Hörspektrum, welches sich über annähernd zehn Oktaven erstreckt. Werden solche Systeme dennoch als Vollbereichswandler eingesetzt, führt dies an den Rändern des Spektrums häufig zu unfeinen Verzerrungen, auch fehlt dort vielfach der nötige Schalldruck.
Selbst wenn es gelingt, den Frequenzgang bei axialer Messung durch allerlei Kniffe gerade zu bekommen, haben Breitbänder bei hohen Frequenzen Probleme, weil die auf die Wellenlängen bezogen sehr großen Membranen die Schallwellen stark bündeln. Eine ausgewogene Energieverteilung über alle Raumwinkel ist damit im Regelfall nicht erzielbar. Da der Klangeindruck maßgeblich von der Gesamtenergie geprägt wird, klingen die meisten Breitbänder doch eher mittenbetont und in den Höhen zurückhaltend.
KEF treibt bei seinem Uni-Q einen branchenweit einmaligen Aufwand, will so bei Linearität und Zeitverhalten gleichermaßen Bestmarken setzen. Die beiden Alumembranen wie auch die dahinter befindlichen Antriebe sind so geformt und positioniert, dass beide akustischen Zentren am gleichen Ort liegen, so dass keinerlei Wegdifferenzen entstehen. Die gezackte Linse vor der Kalotte und die feinen Rippen auf der Membran des Mitteltöners verstetigen das Winkelverhalten zusätzlich. So bleibt der gesamte Übertragungsbereich frei von Peaks und Dellen, auch um die Trennfrequenz bei 2800 Hertz.

Damit verhält sich das System wie eine singuläre Schallquelle mit gigantischer Bandbreite. Hinzu kommt eine extrem gleichmäßige Energieverteilung auch und gerade bei größeren Raumwinkeln.
Ein weiterer Vorzug der elften Uni-Q-Generation (so die Zeitrechnung des Herstellers) ist sein überragendes Klirrverhalten. Oberhalb 300 Hertz, mit Beginn der sensiblen Mitten, liegen die Verzerrungen der Reference 3 selbst bei Pegeln von 100 dB noch an oder gar unterhalb der Messgrenze.
Die mit über 50 Kilogramm für ihre Größe extrem schwergewichtige Box wird von einer mäßig komplexen Frequenzweiche kontrolliert, die das Verhalten der Treiber weiter perfektioniert. Bei der finalen Erprobung wurden zahlreiche Weichenbauteile getestet, wobei die Entwickler süffisant anmerken, dass die teuersten Bauteile keineswegs immer die Besten waren.
Falls der Anwender es möchte, kann er Punktstrahler und Basstreiber mit getrennten Kabeln oder Endstufen ansteuern. Bei der unkomplizierteren Single- Variante übernehmen drehbare, massive Kontaktstifte die Weitergabe des Signals. Dadurch entfällt das gewohnte, bisweilen ausgesprochen lästige hantieren mit Brücken aller Art.
Mit der gleichen Sorgfalt widmete KEF sich den Gehäusen der Reference 3, die auf maximale Neutralität getrimmt wurden. Die Dimensionierung der Kammern, Verstrebungen und Dämmstoffe ist das Ergebnis komplexer Simulationen. Klangsteller hielt man für entbehrlich, doch immerhin gibt es eine sinnvolle, mechanische Justageoption. Zwei unterschiedlich lange Einsätze für die Bassreflextunnel gestalten den Basscharakter wahlweise etwas straffer oder wuchtiger.

Hörtest
Im AUDIO-Hörraum erwies sich die trockener und dezenter wirkende Variante mit dem längeren Einsatz als besser passend. Obwohl es an der Box bis auf die Stellfüße und die Basstunnel nichts einzustellen gibt, schien das Klangild bereits nach wenigen Takten einzurasten. Selbst das gewohnte Anwinkeln der Boxen zum Hörer, auf das manche Schallwandler wie Mimosen reagieren, kann beim Uni-Q meist entfallen.
Durch das gutmütige Winkelverhalten genossen auch Hörer, die nicht genau im Stereodreieck saßen, eine sehr hohe Durchhörbarkeit. Ebenso erwies sich die Sitzhöhe als unkritisch; lümmeln auf dem Sofa oder hören im Stehen sind hier ausdrücklich erlaubt.
Die Tester konnten mit der Reference 3 feinste Klangfarben ermüdungsfrei genießen, weshalb die Zeit verging wie im Fluge. Die Technik trat komplett in den Hintergrund, denn es gab weder tonal noch dynamisch etwas zu meckern. Nebenbei zelebrierte die KEF einen Detailreichtum, wie wir ihn sonst nur bei exzellenten Kopfhörern erleben.
Impulse aller Art kamen ansatzlos und bei einigen durchaus testbewährten Aufnahmen wurden nie gehörte Schattierungen registriert. Räumliche Feinheiten wurden so mühelos dargereicht, als wäre Verdeckung nie ein Thema gewesen. Von der Soulsängerin Randy Crawford gibt es (erschienen bei Dreyfus) einen Live-Mitschnitt mit dem Song "Last Night At Danceland". Zu Beginn ist im Hintergrund das rhythmische Klatschen des Publikums zu hören, das mit der Reference 3 sagenhaft rein und räumlich erklingt. Konventionelle Boxen machen daraus vielfach nur Brei.
Fazit
Mit bewundernswerter Ausdauer entlockt KEF seinem Uni-Q immer neue Rekorde bei Messtechnik und Klang. Die elfte Generation kommt dem Ideal der dynamisch ansatzlosen, extrem raumrichtig arbeitenden Punktschallquelle so nah wie nur die Allerwenigsten. Dieses Wunderwerk der Akustik klingt sagenhaft klangrichtig.