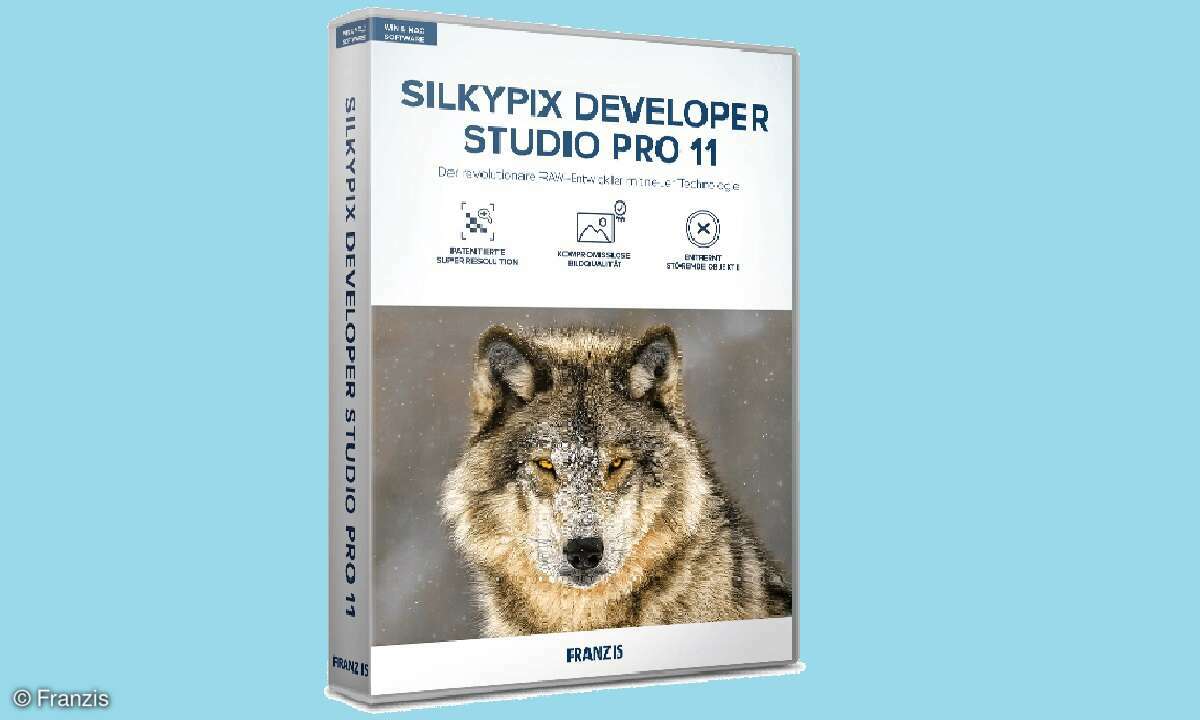Klipsch Palladium P-39 F
Die Klipsch Palladium ist 100 Prozent Dynamik.

- Klipsch Palladium P-39 F
- Datenblatt
Musik braucht Dynamik, und ab und an muss sie auch mal richtig Gewalt ausüben. Ohne Dynamik wäre sie so spannend wie ein Handy-Klingelton. So weit sind sich alle einig. Unterschiedliche Ansichten gibt es dagegen zu der Frage, inwieweit man bei anderen wichtigen HiFi-Kriterien Kompromisse machen da...
Musik braucht Dynamik, und ab und an muss sie auch mal richtig Gewalt ausüben. Ohne Dynamik wäre sie so spannend wie ein Handy-Klingelton. So weit sind sich alle einig. Unterschiedliche Ansichten gibt es dagegen zu der Frage, inwieweit man bei anderen wichtigen HiFi-Kriterien Kompromisse machen darf, um die Dynamik zu maximieren. Klipsch nahm in dieser Diskussion stets eine radikale Position ein. Wobei "stets" hier 60 Jahre bedeutet.

Sechs laute Jahrzehnte
Dynamik, Dynamik und nochmals Dynamik sollte die Firma liefern, die Paul Klipsch im Jahr 1946 in Hope, Arkansas gründete - passenderweise auf einem ehemaligen Artillerie-Testgelände. Jetzt auch mit dem kleinen Enkel des legendären Klipschorn, mit der Palladium. Wie schon die in den 40er und 50er Jahren entwickelten Klipsch-Klassiker arbeitet auch die Palladium mit Hornunterstützung im Mittelhochtonbereich. Hörner verfärben? Nicht, wenn man sie richtig konstruiert. Das Entwicklerteam greift heute auf extrem leistungsfähige Finite-Elemente-Simulationen zurück. Damit lässt sich etwa der Verlauf des Magnetfelds im Treiber, die Wärmeabfuhr über den Korb oder der Einfluss winzigster Geometrie-Änderungen auf den Frequenzgang des Trichters exakt vorhersagen, bevor auch nur ein Modell-Chassis gebaut ist.
Technik vom Feinsten
Drei 22er-Bässe, von denen der obere bis in den Grundton hinein läuft, tragen Alu-Membranen mit einem zugleich dämpfenden und versteifenden Rücken aus Rohacell-Hartschaum. Gleich drei strategisch platzierte Neodym-Magnete pro Chassis sollen garantieren, dass die lange Schwingspule auch bei maximalem Hub (deftige 18 mm) ein völlig homogenes Feld spürt.

Vergleichsweise mikroskopische Hübe, dafür recht hohe Kräfte müssen Horntreiber aushalten. Der Vier-Zoll-Konus des Palladium-Mitteltöners etwa ist zu 80 Prozent von einem Alu-Phaseplug verdeckt, dessen Rücken mit der Membranvorderseite eine Druckkammer bildet. An dieser und an dem daran angeschlossenen Horn (nach der geometrischen Form seiner Wandkrümmung "Tractrix" genannt) haben die Entwickler so lange geforscht und gefeilt, bis auch die letzte der gefürchteten Trichter-Resonanzen weg war. Ähnliche Fürsorge ließen sie natürlich auch dem ab 3,5 Kilohertz einsetzenden Hochtonhorn (mit 25-mm-Titantreiber) angedeihen.
Hörtest
Nicht Verfärbungen machen sie aufregend, sondern allein ihre ungebremste, geradezu orgiastische Dynamik - und das obendrein, dank enorm hohem Wirkungsgrad (AK: 43), an jedem Verstärker diesseits von Single-Ended-Trioden. Wenn Crescendi, Modulationen und feine Betonungen hörbar sind, wo zuvor keine waren, dann ist die Box, die sie hörbar macht, einfach besser als das, was vorher spielte. Einen ebenbürtigen Gegner fand die Klipsch erst in der KEF Reference 207/2 - ein Vergleich, der zwar lebhafte Diskussionen aber letztlich keinen klaren Sieger hervorbrachte. Es ist wohl Geschmackssache: die Britin mit hyperreal gezeichneten Räumen und wasserklarer Transparenz auf der einen Seite, die Amerikanerin mit deutlich direkterer Ansprache und wuchtigerer Tieftonwiedergabe, aber auch mit einer kompakteren und nicht ganz so authentischen Abbildung auf der anderen. Egal, in welcher Beschreibung Sie sich mehr wiederfinden: Hören Sie sich beide an - und staunen Sie.
Klipsch Palladium P 39 F
| Klipsch Palladium P 39 F | |
|---|---|
| Klipsch Palladium P 39 F | |
| Hersteller | Klipsch |
| Preis | 16000.00 € |
| Wertung | 103.0 Punkte |
| Testverfahren | 1.0 |