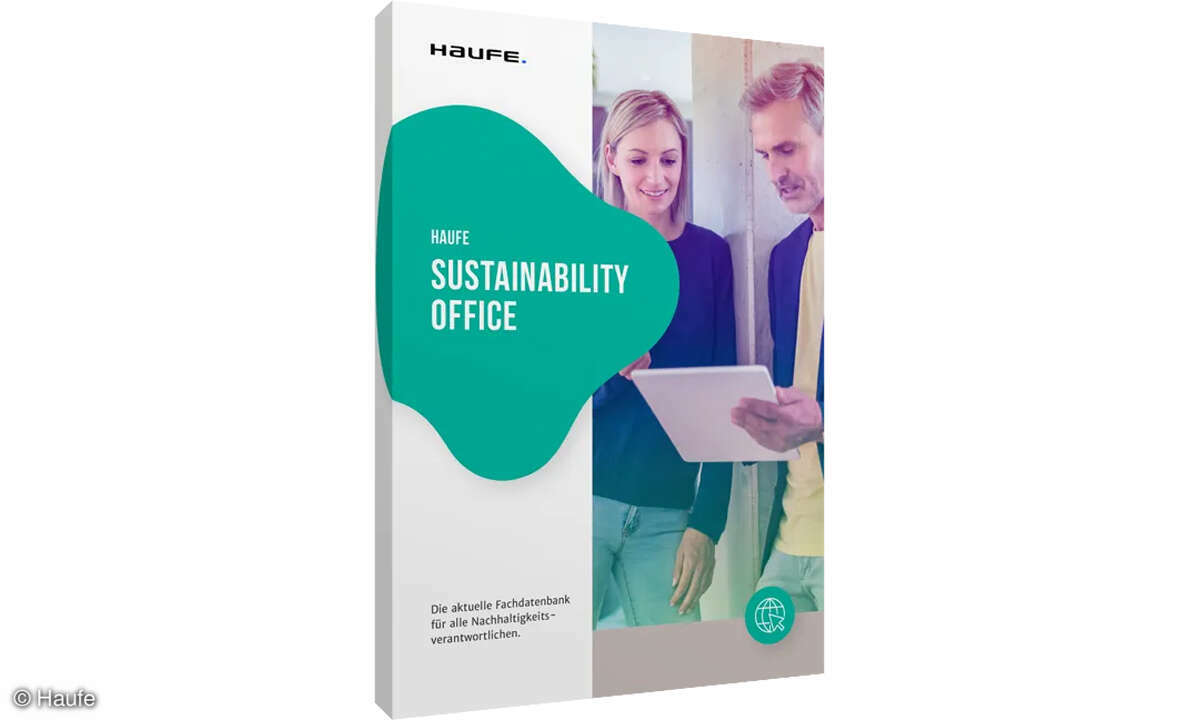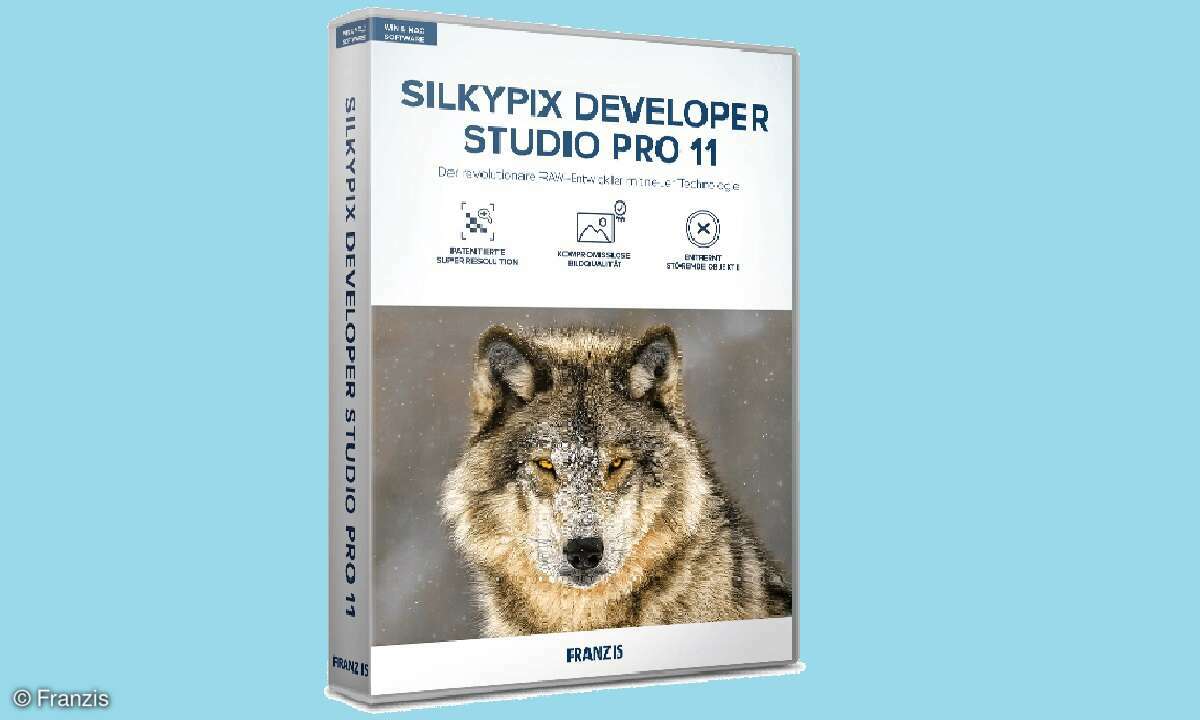Lautsprecher Audio Physic Cardeas
Die neue Audio Physic Cardeas (18000 Euro das Paar), benannt nach römischen Gottheiten, klingt ungewohnt - aber doch himmlisch.

Wo denn die neue Cardeas innerhalb der Audio-Physic-Hierachie anzusiedeln sei? Dem bei der Präsentation anwesenden Geschäftsführer Dieter Kratochwil und seinem Entwickler Manfred Diestertich war die Frage wenig genehm, und sie zögerten bei der Antwort: "Ja, im Grunde schon ganz oben. Technologis...

Wo denn die neue Cardeas innerhalb der Audio-Physic-Hierachie anzusiedeln sei? Dem bei der Präsentation anwesenden Geschäftsführer Dieter Kratochwil und seinem Entwickler Manfred Diestertich war die Frage wenig genehm, und sie zögerten bei der Antwort: "Ja, im Grunde schon ganz oben. Technologisch in jedem Fall."
Und tatsächlich. Die halbaktive Kronos (3/04) läuft aus, und 100_000-Euro-Monstermodelle wie die Cherubin aus den 90ern sind wohl entgültig passe. Damit beschreitet Audio Physic einen Weg, der auch die Branchen-Primusse B&W und Canton so erfolgreich macht: Absolute Spitzentechnologie zu Preisen anzubieten, die irgendwo noch erreichbar scheinen.
Dem entsprechend kommt das neue Technologie-Flaggschiff mit einem Preis von 18_000 Euro, den Maßen von 30 x 120 x 60 Zentimetern und einem Gewicht von 55 Kilo fast dezent daher. Und doch wird an jeder Stelle dieser eleganten Vierwege-Konstruktion deutlich, dass Audio Physic höchsten Aufwand bis ins Kleinste betreibt.

Zum Beispiel beim Gehäuse. Da gibt es ein Kerngehäuse, das wegen seiner vielfältigen Verschachtelungen bereits extrem stabil ist. Um dieses Konstrukt herum zieht Diestertich eine zweite Wand. Beide Wandschichten bestehen aus MDF-Platten, die an den Rundungen innen längs geschlitzt sind; so kann man sie biegen. Aber die Platten sind nicht ganzflächig verklebt, sondern nur an Punkten, an denen das innere Gehäuse wenig schwingt. An allen anderen Flächen entsteht so ein Luftspalt von etwa 1,5 bis 2 Millimeter Breite. Damit ist das Gebilde zwar mechanisch nicht so steif, wie es bei kompletter Verklebung sein könnte. Akustisch aber ist dieses Holz/Luft/Holz-Sandwich (ähnlich einer Doppelverglasung) effizienter, weil weniger Schall aus dem Inneren des Gehäuses nach außen dringt.
Großer Aufwand auch bei den Chassis, die alle in langer, nervenaufreibender Arbeit nach Diestertich'schen Vorstellungen entstehen: Der 26er-Tieftöner mit Aluminium-Membran sowie die gleichgroße Passivkollegin, der vier Zentimeter durchmessende, sehr breitbandige Konushochtöner - auch aus Alu - und die 15er-Mitteltöner (natürlich ebenfalls mit Alu-Membranen), die mit ihren entkoppelnden Körben besonders aufwendig gestaltet sind.

Und damit ist ein wesentliches Stichwort gefallen: Die "Entkopplung" zieht sich nämlich wie ein roter Faden durch das Cardeas-Konzept. Gemeint ist die Entkopplung aller klang-relevanten Bauteile vom vibrierenden Untergrund. Vor 15 Jahren hat Diestertich dafür eine wirkungsvolle Methode mittels dünner Seile entdeckt: das String Suspension Concept (SSC). Längst wurden die Nylon-Fäden gegen fest gespannte Nylon-Netze getauscht, in denen sich jetzt die störenden Vibrationen verfangen sollen.
Womit wir wieder bei den Mitteltönern wären. Die Cardeas-Modelle haben zwei Körbe: einen äußeren, der in der Schallwand verankert ist, und einen inneren, der über ein SSC-Netz straff mit dem äußeren verbunden ist. Aber auch der Hochtöner hängt per SSC-Netz in der Schallwand, und selbst die Anschlussbuchsen sind so entkoppelt. Bei den Treibern hat man so etwas ja schon öfter gesehen. Aber beim Terminal? "Einfach anhören," sagt Diestertich dazu: "Mit SSC klingt es viel klarer." Man darf ihm glauben, weil die kleinen Dämpfer in vielen stereoplay-Tests erstaunlich große Klangsteigerungen in genau dieser Richtung brachten.

Wer so konsequent vorgeht, lässt auch die Frequenzweiche nicht un-entkoppelt. Zudem verwirklicht Diestertich hier eine ungewöhnliche Schaltung (siehe Kasten unten) und lässt sogar ein wenig Esoterik einfließen: Auf den Kondensatoren kleben Gabriel-Chips, die den Elektrosmog reduzieren sollen und derzeit in den Foren heiß diskutiert werden. Bei Audio Physic bleibt man da gelassen: "Wer es nicht hört, muss es ja nicht kaufen. Für uns ist es erheblich besser."
Noch einmal zurück zu den 15er-Mitteltönern. In der Cardeas arbeiten gleich drei davon. Der mittlere verarbeitet 350 bis 2700 Hertz; die äußeren laufen quasi noch im Bassbereich: von 100 bis 350 Hertz. Und das ist wohl nicht ganz einfach. Die Verzerrungs-Werte der Cardeas sind zwar über den gesamten Bereich sehr niedrig, aber bei 80 und 250 Hertz zeigen die beiden Tiefmitteltöner Klirrspitzen. Ebenfalls auffällig ist der schlanke Tiefton. "Natürlich können wir auch mehr Bass", versichert Diestertich. "Aber die meisten Musikfans haben kleine Räume, und da versagen 90 Prozent der üblichen Lautsprecher. Auch unsere."

Und tatsächlich klang die bewusst bassarm abgestimmte Cardeas im stark bedämpften stereoplay-Hörraum erst einmal ungewohnt schlank. Aber schon bei den ersten Takten Musik wurde deutlich, dass wir es hier mit einem Schallwandler zu tun hatten, dessen leichtfüßige Feinzeichnung und ungemein plastische Darstellung womöglich Maßstäbe setzen könnte. Wenn nicht dieser etwas dünnliche Bass wäre... Doch mit stückweisem Heranschieben an die Rückwand wurde es immer besser, das Klangbild von unten immer voller. Bei 40 Zentimeter Abstand war es dann genug. Und auf einmal war von allem genug da: Der sonore Brustton des Livingston Taylor in seinem "Isn't She Lovely" genauso wie die brettharten Bassgitarrenimpulse des Marcus Miller ("Panther") oder die wuchtigen Paukenschläge bei der Erich-Kunzel-Interpretation von Tschaikovskys "1812". Bei der richtigen Aufstellung kann dieser Lautsprecher richtigen Tiefgang produzieren - und bleibt dabei immer präzise.
Diese Wiedergabe-Präzision zieht sich durch bis in die obersten Lagen. Hier ist allerdings nicht die weitverbreitete preußisch-vordergründige Variante gemeint, sondern eine selten gehörte Lockerheit. Die Harfe von Friedemanns "Kleiner Zupfmusik", gemeinhin ein harter Prüfstein, meisterte die Cardeas dank ihrer enormen Antrittsschnelligkeit souverän, ohne wie viele andere "schnell" klingende Lautsprecher ins Raue zu verfallen. Deshalb klingt sie so echt. Man muss jedenfalls kein HiFi-Spezialist sein, um zu hören, dass das Pfeifen von Livingston Taylor über die Cardeas absolut natürlich klingt oder ihre dreidimensionale Abbildung geradezu atemberaubend ist.
Am Ende standen 65 Klangpunkte auf den Listen der Tester. Das ist für eine Box unter 20_000 Euro eine kleine Sensation. Addiert man noch die stimmigen Proportionen und das schlüssige Aufstellungs-Konzept, kann es hier nur ein Urteil geben: Highlight!