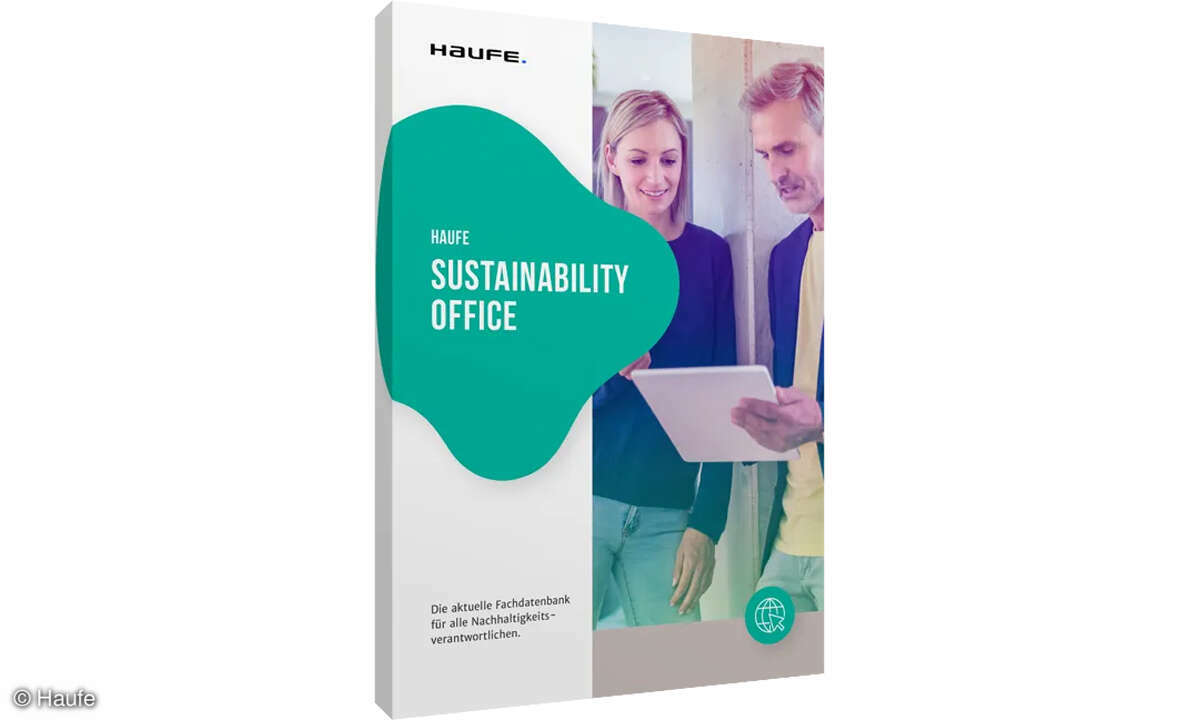Lautsprecher Duevel Sirius
Bei der Duevel Sirius (20000 Euro das Paar) konnte man fast nach Belieben im Raum umherspazieren, ohne nennenswerte Klangveränderungen notieren zu müssen.

- Lautsprecher Duevel Sirius
- Datenblatt
Während Besitzer von Einsteigerboxen bei Vergleichen leicht ins Grübeln kommen, welches Modell welcher Marke sie gerade vor sich haben, besteht bei der Sirius der niedersächsischen Boxenmanufaktur Duevel nicht die geringste Verwechslungsgefahr. Das annähernd mannshohe, in der Draufsicht exakt...

Während Besitzer von Einsteigerboxen bei Vergleichen leicht ins Grübeln kommen, welches Modell welcher Marke sie gerade vor sich haben, besteht bei der Sirius der niedersächsischen Boxenmanufaktur Duevel nicht die geringste Verwechslungsgefahr.
Das annähernd mannshohe, in der Draufsicht exakt quadratische und visuell höchst attraktive Tonmöbel sieht nicht nur anders aus als herkömmliche Boxen, es arbeitet und klingt auch anders. Der Unterschied liegt im Rundstrahlverhalten: Konventionelle Boxen konzentrieren insbesondere Mitten und Höhen auf einen vergleichsweise schmalen Winkelbereich und müssen deshalb mehr oder minder penibel auf den Hörplatz ausgerichtet sein. Logischerweise besitzen solche Schallwandler - die Fachwelt bezeichnet sie als Direktstrahler - eine eindeutig identifizierbare Vorder- und Rückseite.
Die Sirius dagegen sieht aus allen Richtungen gleich aus. Einen Hinweis, wo hinten sein könnte, gibt lediglich das in dieser Teststrecke nicht abgebildete Anschlussterminal, das über eine zuschaltbare Impedanzlinearisierung für Röhrenverstärker verfügt und eine zweistufige Hochtonanpassung zur geschmacklichen Korrektur oder zum Ausgleich ungewöhnlicher Nachhallzeiten.
Tatsächlich zählt die Sirius zur seltenen Gattung der 360-Grad-Rundstrahler, die alle Frequenzen in horizontaler Richtung gleichlaut abgeben. Eine Drehung um die eigene Achse ändert weder Frequenzgang noch Klangcharakter.
Beim Rundstrahler ist die Sitzposition Nebensache

Ob diese nur von wenigen Herstellern gepflegte Bauform Direktstrahlern musikalisch das Wasser reichen kann oder gar natürlicher klingt, dazu gehen die Meinungen bei Technikern und Musikfreunden auseinander. Da bei Rundstrahlern am Hörplatz weniger Direktschall ankommt und dafür stärkere Raumanteile, reagieren sie wankelmütiger auf die akustische Beschaffenheit des Raumes und die Aufstellung. "Plug and Play" im Sinne von "hinstellen und wohlfühlen" ist bei dieser Bauform daher noch unrealistischer als bei den weniger raumabhängigen Direktstrahlern.
Doch ist der richtige Platz gefunden, dann belohnen Rundstrahler den Anwender mit einer nahezu freien Wahl des Hörplatzes. Der Aufstellungsort darf nahe den Seitenwänden liegen, solange nach hinten mindestens 60 Zentimeter "Luft" bleiben. Im Gegensatz zu konventionellen Boxen, die immer nur dann optimal klingen, wenn die Entfernung zu beiden Boxen annähernd gleich ausfällt (Stereodreieck) dürfen Eigner von Rundstrahlern ihre bevorzugte Hörzone deutlich freier wählen. Da der Schalldruck zudem weniger von der Entfernung abhängt, kommen auch asymmetrische Verhältnisse in Frage, wenn die Möblierung oder der Grundriss dies nahe legen.

Duevel erreicht das 360-Grad-Verhalten durch die Verwendung mehrerer, in Form und Größe penibel abgestimmter Schallführungen, die unmittelbar vor den beiden horizontal montierten Chassis sitzen. Dabei handelt es sich um einen 12 Zoll großen Tiefmitteltöner, dessen 100 Millimeter große Schwingspule mühelos mehrere hundert Watt wegsteckt. Der wuchtige, aus dem professionellen Bereich stammende Treiber sorgt für einen vorteilhaft geringen Wattbedarf und beschert dem Anwender ähnlich der Ayon enorme Freiräume in Sachen Verstärkerwahl.
Für die Mitten oberhalb 800 Hertz wie auch den gesamten Hochtonbereich ist ein dreieinhalb Kilogramm schwerer, hoch belastbarer Horntreiber zuständig, der dem 12-Zöller mühelos Paroli bietet. Kontrolliert wird das Ganze von einer sackschweren Frequenzweiche mit rund 25 Bauteilen und sogenannten Serien- anstelle der üblichen Parallelfilter.
Die Stabilität des Gehäuses profitiert von zahlreichen Verstrebungen und der horizontalen Einbaulage. Die auf und ab schwingenden Membranen erzeugen in der hoch aufragenden Säule keine Kippmomente, die Rückstoßkräfte versacken in der schieren Masse von immerhin 75 Kilogramm pro Stück.

Der Eindruck überragender dynamischer Souveränität in allen Frequenzbereichen prägte den Umgang mit der Sirius von Beginn an, auch und gerade im vielfach so heiklen Grundtonbereich. Die explosive Härte und Strahlkraft voll ausgereizter Konzertflügel bereiteten der Duevel an strompotenten Transistorverstärkern wie den McIntosh-Monoblöcken MC 1.2 KW (Heft 5/2008) nicht die geringste Mühe. Auch großorchestrale Sinfonik meisterten die Sirius ohne jedes Anzeichen der Überforderung.
Einzelne Sopranstimmen oder auch ganze Opernchöre gelangen der Duevel mit horntypischer Mühelosigkeit und weitgehend verfärbungsfrei, wenngleich geschulte Ohren einen leichten Hang zu kantiger Überprägnanz feststellen mussten, die mit der Rücknahme der Hochtonsektion auf die leisere der beiden Schalterstellungen geringer wurde, aber nicht völlig verschwand.
Ähnlich wie die Ayon konnte die Duevel ihr überragendes Dynamikpotential erst mit Transistorboliden vollumfänglich entfalten, die Leistungswerte im Kilowattbereich stemmen. Tonal und rhythmisch jedoch schien sich die Box an Röhren eindeutig wohler zu fühlen. Selbst der vergleichsweise schmächtige A 55 T von Cayin (Heft 1/2006) konnte die Sirius kraftvoll und ganzheitlich anschieben und geriet erst bei sehr komplexen Klängen an seine Grenzen.

Die prägende Besonderheit der Sirius war ihre räumliche Abbildung, die erheblich raumgreifender ausfiel als gewohnt. Während die im übernächsten Abschnitt zu besprechende Geithain Position und Entfernung von Einzelstimmen geradezu holografisch genau darstellen konnte, tendierte die Sirus zu einer schwelgerischen, Weite und Tiefe des Raumes betonenden Sichtweise. Was programmabhängig mal auf große Zustimmung stieß, mal schlicht nebulös wirkte.
Auch mit dieser Besonderheit erschien der Gesamteindruck stimmig und homogen, auf jeden Fall ansprechend und faszinierend entspannt, ohne Druckgefühl. Ein ganz eigenes Erlebnis war die völlige Aufhebung des Stereodreiecks. Wo Ayon und Geithain ihre Hörer an die gewohnten Sitzplätze fesselten, als hätten sie Handschellen im Gepäck, konnte das Gremium bei der Duevel fast nach Belieben im Raum umherspazieren, ohne nennenswerte Klangveränderungen notieren zu müssen.
Selbst 30 Zentimeter vor einer Box war das andere Exemplar noch so deutlich zu hören, als hätte jemand am Balanceregler nachgeholfen, was faktisch nicht der Fall war. Für Freiheitsliebende sind die rundstrahlenden Sirius auf jeden Fall eine dicke Empfehlung.
Duevel Sirius
| Duevel Sirius | |
|---|---|
| Duevel Sirius | |
| Hersteller | Duevel |
| Preis | 20000.00 € |
| Wertung | 61.0 Punkte |
| Testverfahren | 1.0 |