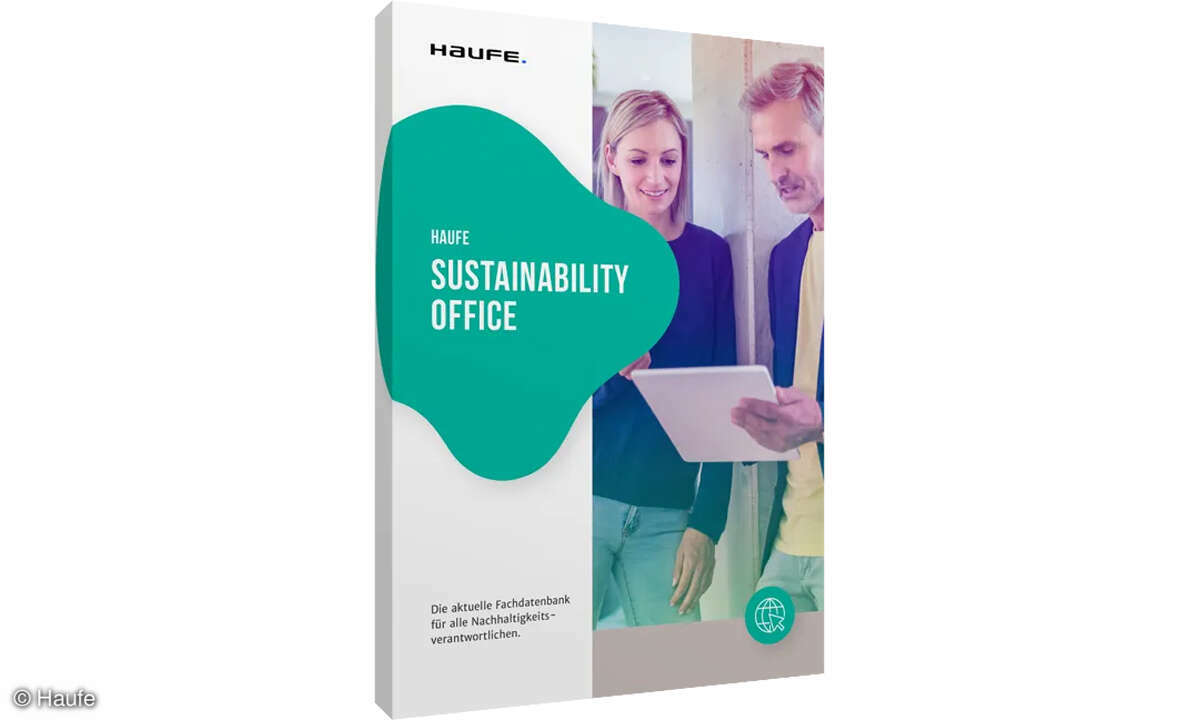CD-Spieler Harman/Kardon HD 990
Der CD-Player Harman/Kardon HD 990 (600 Euro) bietet nicht nur einen speziellen Ausgang mit den er sich digital an Verstärker HK 990 aus eigenem Hause verbinden läst, sondern auch einen detailreichen Klang mit dem internen Wandler.

- CD-Spieler Harman/Kardon HD 990
- Datenblatt
Für 600 Euro steht der Harman HD 990 als preiswertester Player mit symmetrischen Ausgängen da. Ebenfalls phänomenal: Über je einen optischen und drahtgebundenen Digitaleingang akzeptiert er Samplingfrequenzen von 32 bis 96 Kilohertz und bietet seine Wandlerfertigkeiten beispielsweise Satellitenr...

Für 600 Euro steht der Harman HD 990 als preiswertester Player mit symmetrischen Ausgängen da. Ebenfalls phänomenal: Über je einen optischen und drahtgebundenen Digitaleingang akzeptiert er Samplingfrequenzen von 32 bis 96 Kilohertz und bietet seine Wandlerfertigkeiten beispielsweise Satellitenreceivern oder DVD-Playern an, um deren meist bescheidene Zweikanal-Klangqualität aufzuwerten.
Nun fragen sich Netzgänger, ob der HD 990 über seinen Ethernetanschluss (üblich zur Verbindung in lokalen Datennetzen) sogar High-Resolution-Musikfiles aus dem Internet downloaden kann? Leider nein: Über die RJ45-Buchse namens HRS-Link (High Resolution Synchronisation) und das beigepackte Kabel holt er sich Taktdaten vom markengleichen (ebenfalls in Heft 7/09) getesteten Stereo-Verstärker HK 990, dessen D/A-Wandler die angelieferten Musikdaten somit optimal verarbeiten kann.
Die Streichholz-Tästchen des Harman verlangen Fingerspitzengefühl, die Beschriftung am Player und auf der Fernbedienung ist bei Dämmerlicht schwer ablesbar.
Das Innenleben des Harman erinnert eher an einen DVD-Spieler. Ein großzügig dimensioniertes Schaltnetzteil versorgt die Mechanik und die Elektronik mit Strom. Die zentrale Schaltstelle im Player heißt "Black-Fin", ein für multimediales Audio und Video entwickelter Hochleistungsprozessorbaustein des amerikanischen Schaltungsspezialisten Analog Devices.

Er decodiert datenreduziertes MP3 und erhöht mit einer asynchronen Abtastratenwandlung den Pulsschlag der CD von 44,1 auf 384 kHz. Asynchron bedeutet, dass die frische Taktfrequenz - anders als beim klassischen Oversampling - komplett neu errechnet wird. Der Vorteil: Die jungen Daten stehen in keiner Relation mehr zu den Ursprungswerten samt ihren Fehlern.
Doch das ist nicht der einzige Trick im Harman. Bei der Wandlung besannen sich die Entwickler zurück auf eine Finesse im 4/93 getesteten HD 7725. Das Antiverzerrungskonzept RLS (Real Time Linear Smoothing) teilte den Datenstrom auf zwei Wandler auf; einer erhält ihn um einen Abtastwert zeitversetzt. Das Differenzsignal beider Konverter spiegelt den Verlauf der Ausgangskurve wider. Damit speiste Harman einen Kondensator, der seine Spannung nicht sprunghaft, sondern nur stetig ändern kann und somit das treppenförmige Wandler-Ausgangssignal glättet. Im HD 990 kommt die dritte Generation von RLS zum Einsatz. Bei der eigentlichen Datenumsetzung sind dieselben Konverter-ICs wie im Vollverstärker HK 990 im Einsatz. Ab den D/A-Wandlern behandelt er invertiertes und nichtinvertiertes Signal separat bis zu den symmetrischen Ausgängen.

Die Dokumente aus dem Messlabor unterstreichen nochmals die Unterschiede zwischen den Playern. Aus dem zugeschalteten Filter resultiert beim NAD ein leichter Höhenabfall im Frequenzgangschrieb. Beim Harman endet die Linie erst etwas über 40 kHz, wenn die Digitaleingänge das Mess-Signal entgegennehmen. Vorbildlich: Der Jitter, also zeitliche Unpässlichkeiten im Analogsignal, liegt bei beiden extrem niedrig.
Die entscheidende Frage nach dem Klang kann aber nach wie vor nur der Hörtest beantworten. Schon über seine Cinch-Ausgänge erwies sich der Harman als Player, der Details genau fokussierte und die Wiedergaberäume vorstellbar und großflächig nachzeichnete. Allerdings klangen Orchester etwas farblos, bei kernigen Rockklängen mangelte es minimal an treibender Kraft im Bass.
Der Gegner NAD bildete die Aufnahmeräume kompakter ab, verlieh den Handlungen auf der Bühne aber deutlich mehr Fluss. Der Bass wirkte straffer, die Klangfarben der Instrumente intensiver. Die Jury wünschte sich ab und zu etwas mehr Präsenz und Griffigkeit, besonders bei zugeschaltetem Filter: Es bremste den NAD etwas aus. In weiteren Vergleichen zeigte sich der Cambridge Azur C 640 V 2 (3/06, 54 Klangpunkte) als adäquater Gegner: Er verlieh Gitarren mehr Eleganz und bildete Stimmen schlanker ab, der NAD koppelte dafür die einzelnen Akkorde und Instrumentierungen nahtloser.

Klarer Gewinner im Paarlauf NAD/Harman war der C 545 BEE. Schade vor allem, dass der HD 990 in tieferen Klangregionen etwas die Flügel hängen ließ. Aber es standen ja noch weitere Hördurchgänge bevor.
Vor allem war zu klären, ob der Harman über seine symmetrischen Ausgänge mehr Klangpunkte erreicht. Im Vergleich Symmetrisch contra Cinch sorgte die XLR-Verbindung für etwas geschmeidigere Bewegungen. Hatte zuvor die Stimme der britischen Folkrock-Legende Richard Thomson (von der CD "Across A Crowded Room") etwas rau und statisch geklungen, verschwanden über die XLR-Ausgänge die harschen Spitzen. Die Läufe von dem Stück "Fire In The Engine Room" gewannen an Dramatik, der Bass wurde straffer. Doch atmosphärische Klänge, etwa von Loudon Wainwrights "Social Studies", setzte nach wie vor der NAD blumiger in Szene.
"Noch immer tendenziell etwas unbeteiligt", notierten die Tester, wenn ein anerkanntes CD-Laufwerk die Musikdaten über den Cinch-Digitaleingang zuspielte und der Harman die Analogsignale symmetrisch ausgab. Aber: Der Bass gewann nochmals an Kontur, der Informationsgehalt nahm zu.
Zeichnete sich vielleicht im Zusammenspiel mit dem markengleichen Vollverstärker (ebenfalls stereoplay 7/09) eine Sensation ab? Die Tester verglichen die analogen, symmetrischen, SPDIF- und HRS-Link-Eingänge und fanden eine klare Rangfolge. Auf dem letzten Platz landete die analoge Cinch-Marschroute, klare Nummer eins war der Datenkurs über die Ethernet-Verbindung. Übernahm der Verstärker HK 990 die Datenumsetzung, wurde der Klang lebendiger, das Timing erheblich flüssiger. HRS-Link stellt also die kleinen Schwächen des Players solo ab. HD 990 + HK 990 sind ein Dreamteam. Wie füreinander geschaffen.
Harman / Kardon HD 990
| Harman / Kardon HD 990 | |
|---|---|
| Harman / Kardon HD 990 | |
| Hersteller | Harman / Kardon |
| Preis | 600.00 € |
| Wertung | 53.0 Punkte |
| Testverfahren | 1.0 |