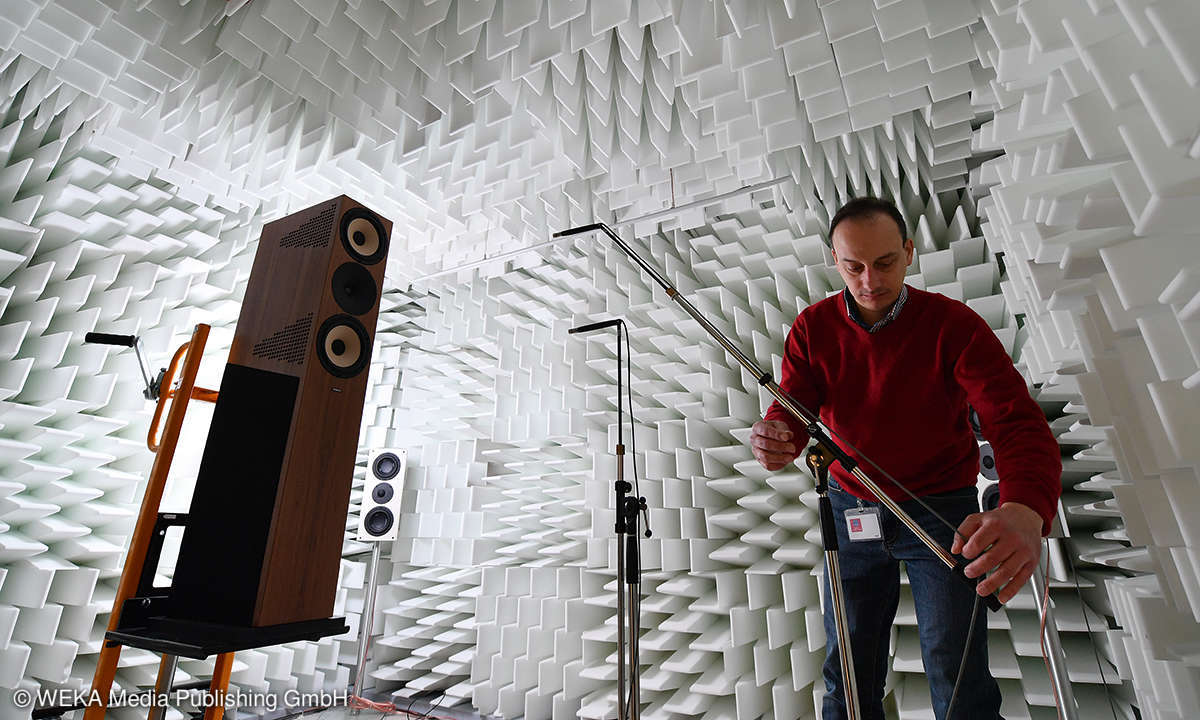Klang verbessern durch Raum-Tuning
Die Raumakustik zu verbessern bringt oft mehr Klanggewinn als neue Komponenten anzuschaffen. Checken Sie Ihre Wiedergabequalität und verbessern Sie den Klang mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung und den kostenlosen "Hausmitteln" oder fertig erhältlichen Raumakustik-Elementen.

Dass Boxen nicht optimal im Regal spielen und freie Fensterflächen den Klang verschlechtern, gehört noch zu den bekannten Fakten über Raumakustik. Ebenso ist das gleichseitige Stereodreieck zwischen Boxen und Hörer gesichertes Basiswissen. Doch die Interaktion zwischen Raumakustik und der aufges...
Dass Boxen nicht optimal im Regal spielen und freie Fensterflächen den Klang verschlechtern, gehört noch zu den bekannten Fakten über Raumakustik. Ebenso ist das gleichseitige Stereodreieck zwischen Boxen und Hörer gesichertes Basiswissen. Doch die Interaktion zwischen Raumakustik und der aufgestellten HiFi-Anlage ist durchaus komplex. Es lohnt sich daher, die Schwächen des Hörraums zu analysieren und schrittweise zu optimieren.
1. Nachhallzeit verringern
Je mehr harte, reflektierende Flächen (Stein, Beton, Parkett, Glas etc.) in einem Raum offen zu sehen sind, desto stärker wird der Raum auch hallen. Ein guter Anhaltspunkt ist hierbei die Nachhallzeit, die man per Klatschen oder durch Einsatz eines Knackfrosches selbst hören kann: Je länger der Hall "nachschwingt" oder sogar kurze, schnarrende Echos zu hören sind, desto höher ist die Nachhallzeit. Materialien, die den Schall zumindest in bestimmten Frequenzbereichen absorbieren, helfen bei einer Verringerung derselben: Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, abgehängte Stoffbahnen, offene, gefüllte Bücherregale.

Doch Vorsicht: Viele Materialien wie Holz und dünne Stoffe dämpfen nur die Höhen deutlich, lassen Mitten und Bässe jedoch beinahe unbeeinflusst. Dann erscheint zwar der Nachhall dunkler und wärmer, bei Musikwiedergabe kann es jedoch unangenehm topfig und plärrend klingen. In diesem Fall helfen nur dickere Absorber etwa aus Schaumstoff, die auch den Mittelton bedämpfen und die man auch hinter Bilder oder Deckenverkleidungen verbergen kann.
Wer von Anfang an auf dickere und dichtere Materialien setzt - etwa Stoffsofas, hochflorige Teppiche, Sitzsäcke, Deckenpaneele aus Schaumstoff und schwere/mehrlagige Vorhänge - der hat eine deutlich bessere Ausgangssituation.
2. Für Diffusion sorgen
Von Schallreflexionen an einer einzigen Fläche, die geballt und kurze Zeit nach dem direkten Schall beim Hörer eintreffen, lässt sich das Gehör stärker irritieren als von einem gleichmäßigen Hallfeld mit mehrfach reflektierten Schallanteilen. Ebenso sind echoähnliche Reflexionen, die in gleichmäßigem Takt zwischen zwei Wänden hin- und herlaufen, deutlich störender als chaotisch im Raum verteilte.

Wer seinen Raum von vornherein mit schrägen Wänden oder schräg platzierten Schränken/Regalen ausstatten kann, ist im Vorteil. Auch großflächige offene Bücherregale, Pflanzen mit großflächigen, harten Blättern (wie Palmen) oder verwinkelte, offene Regale wirken zuweilen Wunder. Problematisch sind dagegen Glasvitrinen oder Schranksysteme mit glatter, durchgehender Front.
3. Echos vermeiden
Reflexionen, die zwischen zwei parallelen, reflektierenden Flächen immer wieder hin- und herwandern, sind für den Räumlichkeitseindruck schädlich. Am besten geht man nach dem "Live End/Dead End"-Konzept vor: Ist eine Wand unverkleidet, sollte jene auf der anderen Seite großflächig absorbierend gestaltet werden, etwa durch ein Bücherregal oder poröse Absorber. Ist die Decke schallhart, hilft ein großer Hochflorteppich.

4. Symmetrie schaffen und Seitenwand-Reflexionen verringern
Für die Qualität der Stereowiedergabe ist es wichtig, dass die linke und die rechte Box in ähnlicher akustischer Umgebung aufgestellt sind. Vor allem die Seitenwände links und rechts neben den Boxen sowie der Boden zwischen Box und Hörplatz sind entscheidend, denn hier entsteht die erste Reflexion, die den Hörer direkt nach dem direkten Schall erreicht.
Steht etwa ein Lautsprecher direkt neben einer großen Glasfläche und der andere neben einem freien Durchgang, ist eine schlechte Abbildung und gestörte Räumlichkeit fast immer die logische Folge. Ein Dreh am Balance-Regler hilft hier wegen des hinsichtlich Zeit und Frequenzabhängigkeit verzerrten Schallfeldes nicht. Man sollte sich also Gedanken machen, wie man die Boxen möglichst frei mit identischem Abstand zu den Seitenwänden aufstellen kann.

Befindet sich neben der linken Box etwa ein Bücherregal, ist es sinnvoll, auch neben der rechten ein akustisch ähnliches Regal zu platzieren. Sind die beiden seitlichen Wände möbelfrei, empfiehlt es sich, jeweils einen Schaumstoff-Absorber oder ein Absorber-Bild genau dort neben den Lautsprechern anzubringen, wo die erste Schallreflexion nach der Regel "Einfallswinkel = Ausfallswinkel" entsteht.
Falls sich die Symmetrie nicht herstellen lässt und auch der Mono-Test kein zufriedenstellendes Ergebnis bringt, ist eine Neuanordnung der Möbel und der Anlage oft eine gute Idee. So kann man etwa die gesamte Positionierung um 90 Grad im Raum drehen.

5. Platz oder Bedämpfung hinter dem Hörer schaffen
Hörplätze direkt vor einer Wand sind aus mehreren Gründen akustisch ungünstig: Hier sammeln sich nicht nur die dröhnenden Raumresonanzen, sondern auch diskrete Reflexionen. Ein Hörplatz mit 50 Zentimetern, besser einem Meter und mehr vor der Rückwand, klingt meist ausgewogen klarer und räumlicher. Ist das nicht möglich, sollte ein Diffusor oder Absorber hinter dem Hörer installiert werden oder wenigstens ein Bücherregal oder Pflanzen mit großflächigen dicken Blättern.
6. Wand, Regal und Bass
Je näher die Lautsprecher zur Wand hinter ihnen stehen, desto stärker wird der Tiefbass angehoben. Zugleich werden die gefürchteten Raumresonanzen stärker angeregt, wenn zwischen Box und Rückwand nur 90 Zentimeter Platz oder weniger liegen. Noch extremer ist die Situation, wenn Kompaktboxen in einem Regal platziert sind. Ist der Bass in irgendeiner Weise zu fett, dröhnt oder spielt "langsam", heißt es: Boxen weg von der Wand rücken, bis der Bass präziser wird.

Basstaugliche Kompaktboxen gehören auf einen Ständer und nicht ins Regal. Wer die optimale Positionierung für den Bass sucht, kann zum Bass-rückwärts-Trick greifen. In Extremfällen, wenn ein ausreichender Wandabstand nicht realisierbar ist, kann man es auch mit einem Verschließen eines oder mehrerer Bassreflexrohre (verdichteter Stoff oder Schaumstoff) versuchen.
7. Stereodreieck und Hörabstand
Sowohl bei Zweikanal-Stereo als auch bei Mehrkanal sollten die Front-Lautsprecher mit dem Hörer ein annähernd gleichseitiges Dreieck bilden: Der Abstand vom Hörplatz zum linken sollte identisch sein mit dem zum rechten Lautsprecher (Toleranz weniger als fünf Zentimeter), der Abstand zwischen den beiden Boxen kann leicht (+/-10%) davon abweichen. Wie stark und in welche Richtung, sollte man per Hörexperiment herausfinden.

Zunächst gilt es, den optimalen Hörabstand zu finden: Ein kleineres Stereodreieck (unter zwei Metern Hörabstand spricht man vom Nahfeldhören) sorgt oft für eine sehr gute Ortungsschärfe, lässt den Raum aber klein und eingeschränkt erscheinen. Ein zu großer Hörabstand dagegen klingt oft diffus, verwaschen und überräumlich, Stimmen sind zunehmend schlecht ortbar. Den idealen Kompromiss findet man am besten mit dem Mono-Test: Man geht von einem kleinen Stereo-Dreieck aus, ermittelt die Ortungsgenauigkeit und rückt dann die Boxen in Schritten von 15 oder 20 Zentimetern vom Hörer weg. Der ideale Hörabstand ist meist dort, wo die Mittenortung gerade noch stabil und scharf ist.
Besitzer von bündelnden Lautsprechern wie Hörnern oder Elektrostaten haben es hier besser: Diese ermöglichen auch in weitem Abstand noch eine gute Ortbarkeit.
8. Einwinkeln für Profis
Sollen die Boxen nun parallel zur Wand aufgestellt oder in 20, 30 oder gar 45 Grad eingewinkelt werden? Die Einwinkelung beeinflusst gleich drei Wiedergabekriterien, und zwar deutlich: die Klangfarbenneutralität, die Abbildungsgenauigkeit und die Räumlichkeit. Die meisten Lautsprecher strahlen außerhalb der idealen 90-Grad-Achse weniger Schall in den oberen Mitten und Höhen ab.

Es empfiehlt sich also, mit einer direkt auf den Hörer gerichteten Aufstellung die Experimente zu beginnen: Klingen die Höhen zu spitz oder ist das Klangbild insgesamt zu hell, müssen die Boxen vom Hörer weggedreht werden - ob nach außen oder nach innen, ist für die Klangfarben nicht entscheidend. Ein Wegdrehen nach außen hin zur parallelen Aufstellung vergrößert meist den Räumlichkeitseindruck, kann jedoch auch die Ortbarkeit verschlechtern und für weitere Hörer, die neben dem Haupthörplatz sitzen, die Abbildung zusätzlich verschlechtern.
Eine Einwinkelung nach innen, also 35 bis 50 Grad zur Wand, verbessert oft die Ortbarkeit, kann aber zu einer begrenzten Räumlichkeit führen. Hören mehrere Personen nebeneinander, ist dies aber fast immer zu bevorzugen, um allen eine gute Mittenortung zu ermöglichen.