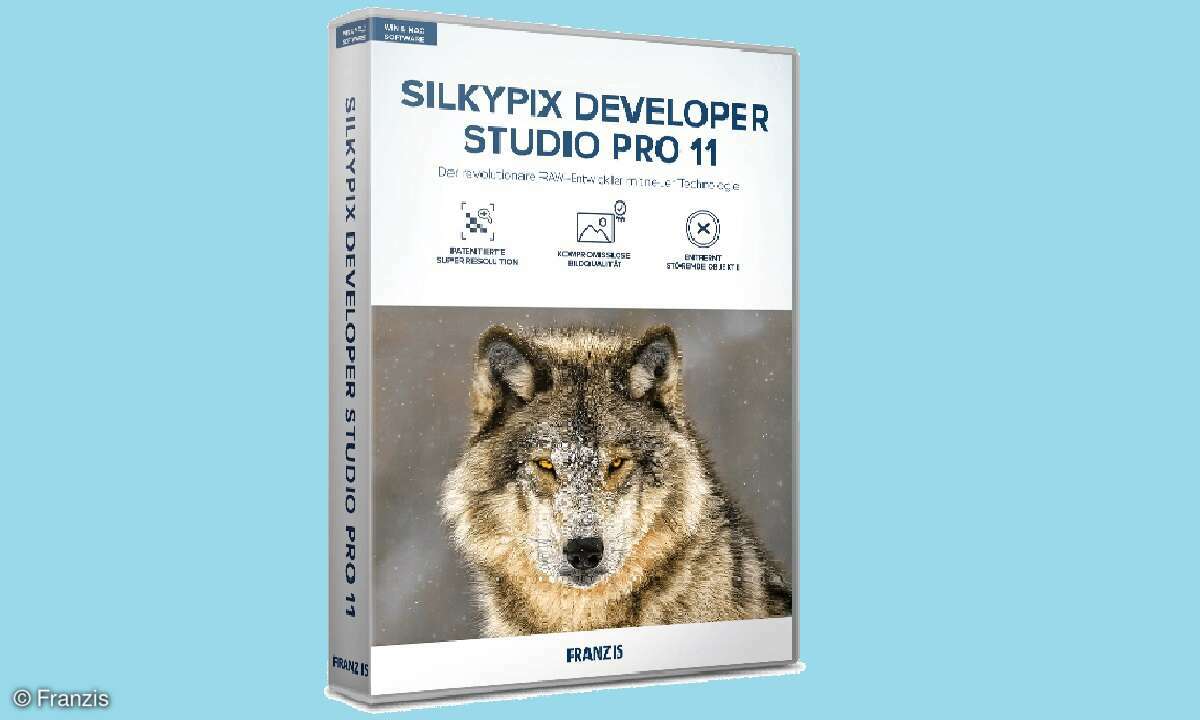Phonostufe Naim Superline + Hi-Cap
Die Phonostufe Naim Superline + Hi-Cap spielte auf dem Niveau der stereoplay-Referenz Aesthetix Rhea.

- Phonostufe Naim Superline + Hi-Cap
- Datenblatt
Naim wurde bisher im analogen Lager gern unterschätzt. Was aber kein Wunder ist, denn der Ein-Punkt-Tonarm ARO, vom legendären Guy Lamotte entwickelt, ist zwar klanglich herausragend, doch bisher kaum beachtet. Und wie gut die hauseigenen Phonostufen sind, haben bisher wohl nur Naim-Kunden wahrgen...
Naim wurde bisher im analogen Lager gern unterschätzt. Was aber kein Wunder ist, denn der Ein-Punkt-Tonarm ARO, vom legendären Guy Lamotte entwickelt, ist zwar klanglich herausragend, doch bisher kaum beachtet. Und wie gut die hauseigenen Phonostufen sind, haben bisher wohl nur Naim-Kunden wahrgenommen. Denn alle ohne eine Naim-Vorstufe benötigen zu der 350 Euro teuren Stageline ein externes Netzteil und schreckten schon vor der kleinsten Variante Flatcap 2 X für 830 Euro zurück.

Ein neuerlicher Beweis für Naims Liebe zum Analogen ist nun der Aufschlag mit der Superline. So durfte sich Steve Sells, seines Zeichens Stellvertreter von Entwicklungsleiter Roy George, austoben und eine State-of-the-Art-Phonostufe ersinnen. Dabei schien es ihm konsequent, eine reine MC-Variante zu bauen, da in diesem Bereich die überwältigende Mehrheit der Fans auf Abtaster mit bewegter Spule setzt.
Den Fan mit nicht ganz so dickem Geldbeutel freut es, dass neben dem 4800 Euro teuren auch das Hi-Cap für 1500 Euro die Superline versorgen kann, so bringt es die Kombination auf "nur" 4000 statt auf 7700 Euro.
Wer nun eine auf Netzteil-Overkill basierende Mogelpackung erwartet, wird bei näherer Betrachtung der Superline schnell eines Besseren belehrt. Sie präsentiert sich wie viele Naim-Geräte als gelungene Synthese aus aufwendiger Bauteile-Selektion, clever einfacher Schaltung und ausgetüfteltem Aufbau. So montierte man in Salisbury die Platine nicht einfach in das Gehäuse, sondern schraubte sie auf eine 3,4 Kilogramm schwere Bronzeplatte und entkoppelte diese mit sechs Spiralfedern. Eine ähnliche Beruhigung der Platine ließ Naim schon dem CD-Player 555 (Test 6/06) und der Vorstufe NAC 552 (9/02) angedeihen, und noch mehr als bei diesen kann man bei der Superline durch Lösen der Transportschrauben feststellen, dass die Entkopplung klanglich verblüffend viel bringt. Was kein Wunder ist, arbeitet eine Phonostufe doch quasi im homöopathischen Strombereich, und hier machen sich solche Maßnahmen deutlich bemerkbar.

Doch ein guter mechanischer Aufbau hilft nur, wenn auch die Schaltung gewissenhaft realisiert ist. So entschied sich Sells, die einem großen Folienkondensator mit 220 Mikrofarad Kapazität folgende Eingangstufe nur mit rauscharmen NPN-Transistoren zu konzipieren. Davon schaltet er vier Stück parallel, womit sich ihr Rauschen teilweise auslöscht. Diese Schaltung funktioniert ihrerseits nur einwandfrei, wenn die Transistoren identische Arbeitsbedingungen vorfinden, weshalb sie Sells unter einer Kunststoffkappe zusammenklebte und dort einen Temperatursensor integrierte.
So ist der Arbeitsstrom, den bei der Superline ein parallel geschalteter Metallfilm- und ein Drahtwiderstand einstellen, äußerst temperaturstabil. Dass diese zwei Widerstände im Hörraum ausgesucht wurden, zeigt weiterhin die Akribie, mit der Sells ans Werk ging. Die danach folgende Kaskoden-Stufe mit NPN/PNP-Transistoren erscheint nun schon fast banal.
Dieser folgt ein serielles Filter, das die Hochtonentzerrung nach RIAA übernimmt. In der folgenden Kaskode sitzt in der Gegenkopplung die Tieftonentzerrung der RIAA und ist somit aktiv gelöst. Eine strompotente Class-A-Pufferstufe stellt sicher, dass die Superline auch längere Kabel treiben kann. Der Kontakt zur Außenwelt wird Naim-typisch nicht direkt an der Superline hergestellt, sondern, zwecks eines zentralen Massepunkts, an dem externen Netzteil. Aus demselben Grund frönen die Briten weiterhin DIN-Buchsen, da diese einen zentralen Massepunkt haben.
Dass diese Maßnahmen auch messtechnisch greifen, zeigte die Superline im stereoplay-Messlabor. Dort gab es bis auf die nicht so üppige Übersteuerungsfestigkeit nur Bestwerte zu vermelden. So waren die Tester gespannt, wie sich die Superline im Hörraum schlagen würde. Doch vor den eigentlichen Klangvergleichen ermittelten sie mit den mitgelieferten DIN-Steckern den perfekten Abschluss für die zwei Referenzabtaster Transfiguration Orpheus (11/06) und Lyra Titan i (6/06).

Dabei erwies sich die Besonderheit der Superline, dass sowohl der Abschlusswiderstand als auch die Parallelkapazität veränderbar ist, als klanglich sinnvoll. Für beide Tondosen ergab sich mit dem 500-Ohm-Abschluss das schlüssigste Klangbild, nur steckten für den Titan i noch 5,6 nF Kapazitäten in der dafür vorgesehenen Superline-Buchse, was zu einem entspannteren Hochton führte.
Nun ging es mit dem Netzteil Hi-Cap zum ersten Vergleich mit der superben Clearaudio Balanced Reference (3/05). Zum allgemeinen Erstaunen gab die Superline nicht klein bei. Ganz im Gegenteil: Nicht nur, dass die Superline mehr Klangfarben vermittelte sowie einen druckvolleren Bass verbreitete, sogar in der Paradedisziplin der Clearaudio, immens viele Hochtondetails darzustellen, war die Naim überlegen, da sie auch in diesem Bereich etwas feiner sowie unbegrenzter erschien.
So spielte sie auf dem Niveau der stereoplay-Referenz Aesthetix Rhea (10/04). Denn die etwas wärmeren Farben der Rhea konterte die Superline nebst Hi-Cap mit ausgeprägterer Dynamik, einer stabileren Raumdarstellung sowie etwas muskulöserem wie auch konturierterem Bass.
Naim Audio Superline + Hi-Cap
| Naim Audio Superline + Hi-Cap | |
|---|---|
| Naim Audio Superline + Hi-Cap | |
| Hersteller | Naim Audio |
| Preis | 3800.00 € |
| Wertung | 61.0 Punkte |
| Testverfahren | 1.0 |