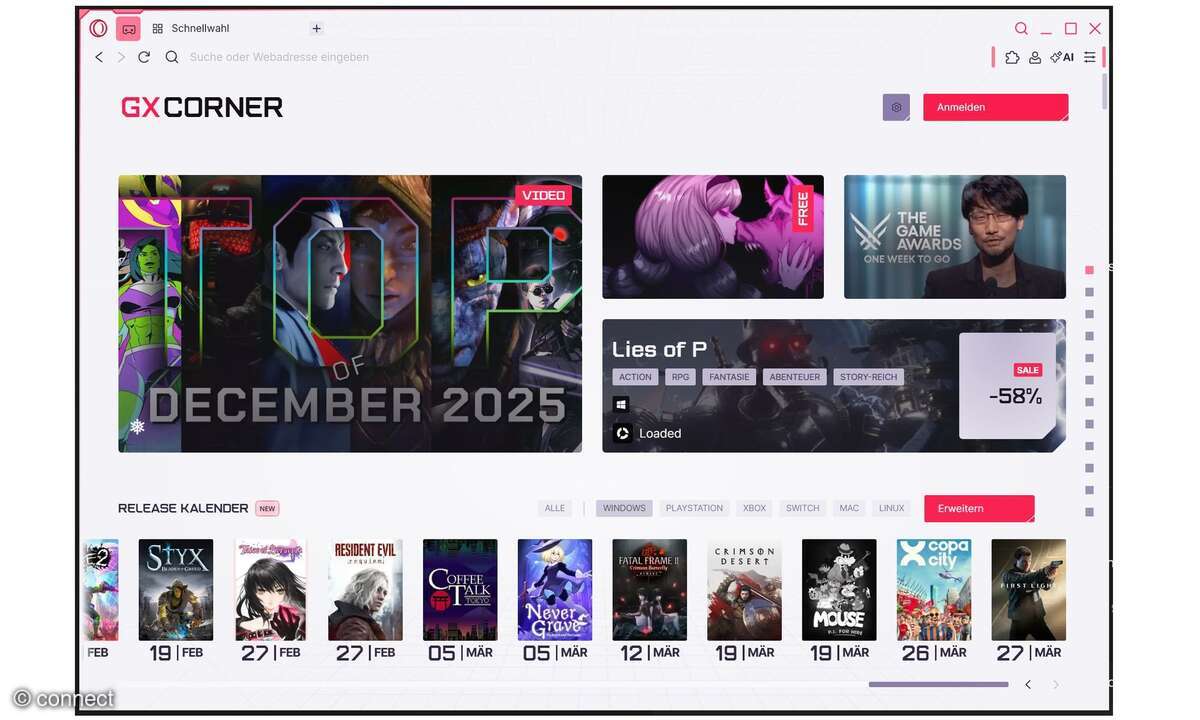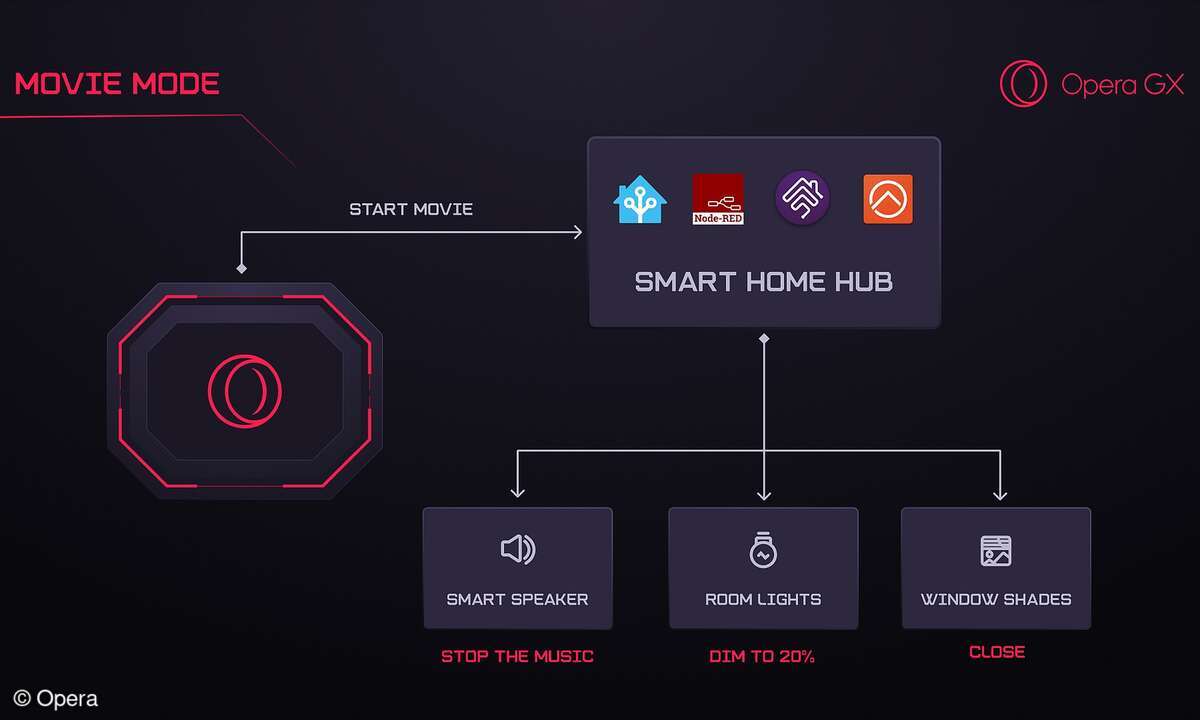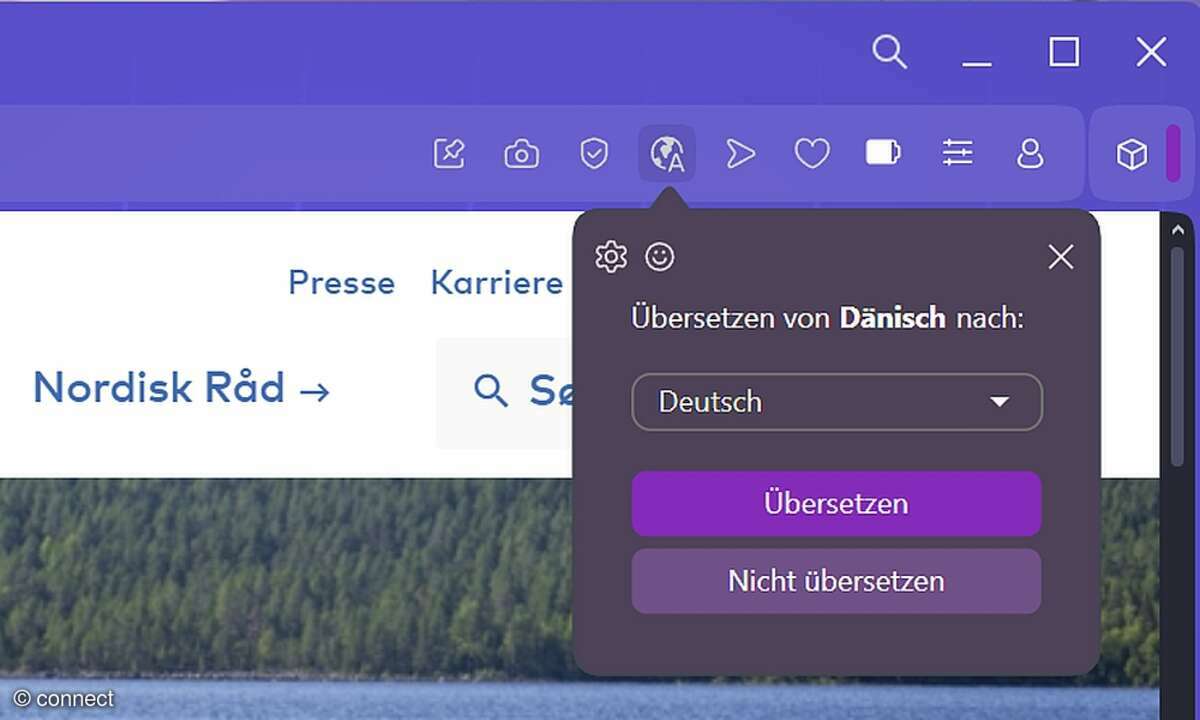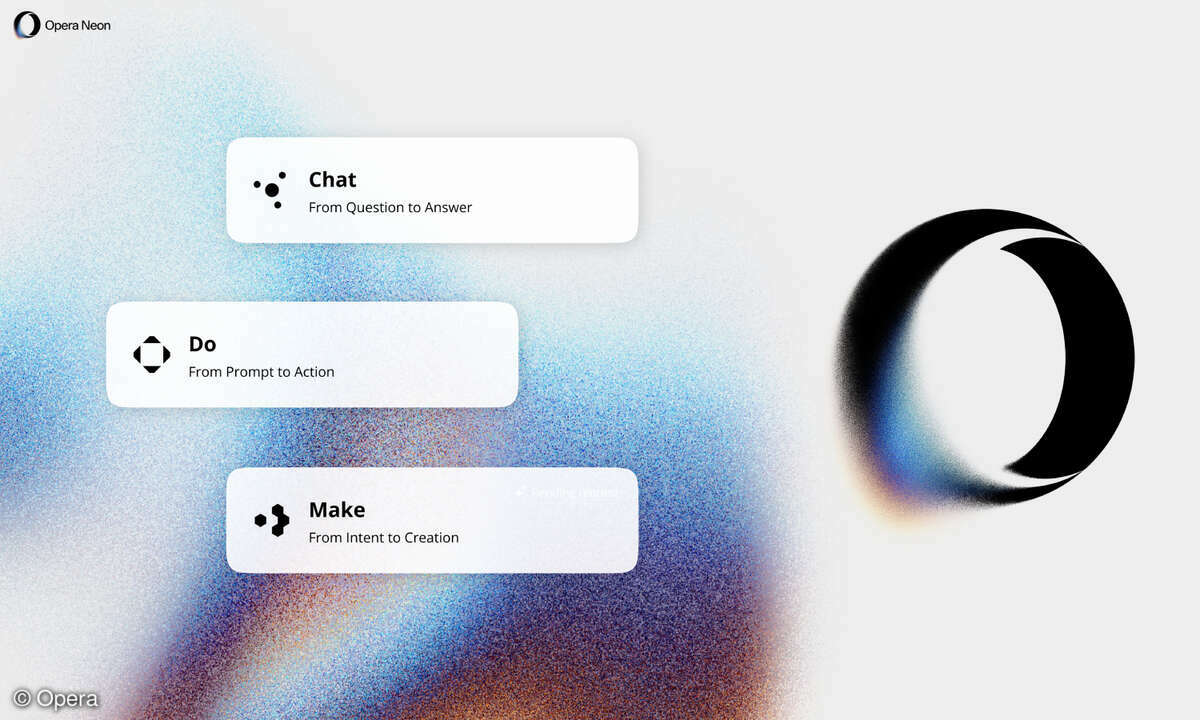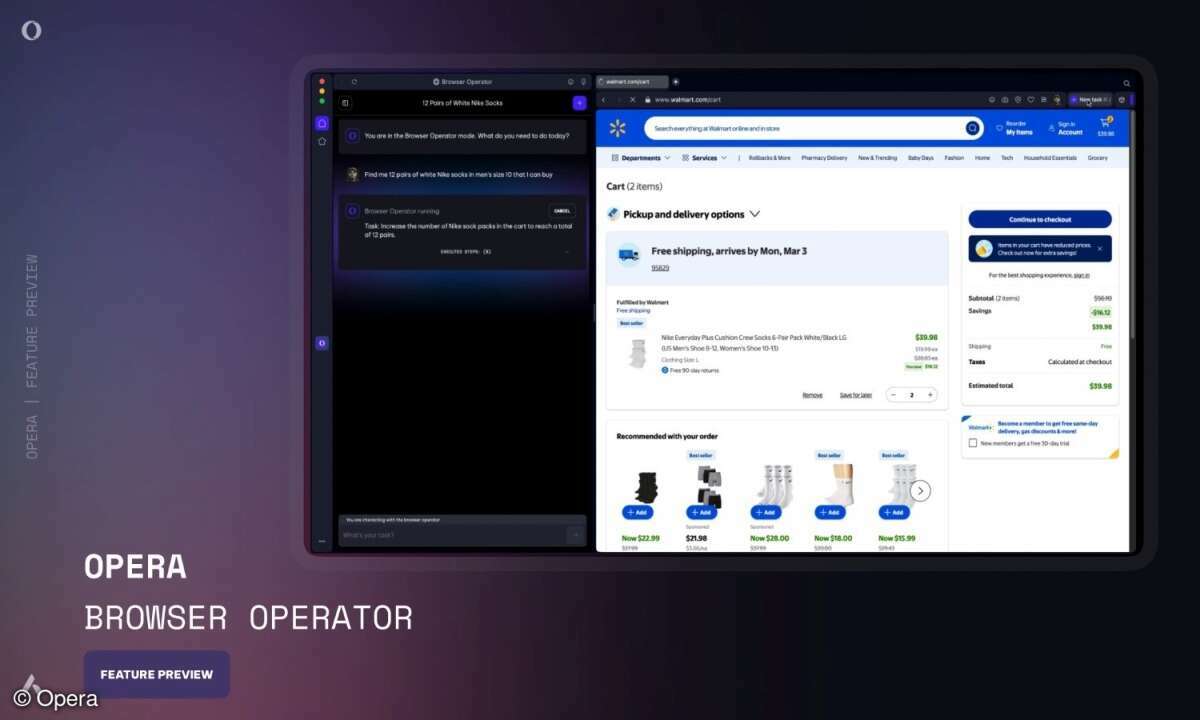Opera Audio Isolde im Test
Der Opera Audio Isolde erfreut Analogfans mit klassischem Design. Ob der Plattenspieler auch im Hörraum überzeugen konnte, lesen Sie im Test.

Opera Audio ist ein für chinesische Maßstäbe eher untypischer Hi-Fi-Hersteller: Keine 100 Mitarbeiter sind bei der kleinen, feinen Firma beschäftigt, die auch nicht in irgendeiner Industriewüste steht, sondern in Pekings schickem Künstlerviertel "798" - und das bereits...
Opera Audio ist ein für chinesische Maßstäbe eher untypischer Hi-Fi-Hersteller: Keine 100 Mitarbeiter sind bei der kleinen, feinen Firma beschäftigt, die auch nicht in irgendeiner Industriewüste steht, sondern in Pekings schickem Künstlerviertel "798" - und das bereits seit ziemlich genau 20 Jahren.
Neben einem großen Sortiment an Röhrenverstärkern produziert Opera seit vielen Jahren auch feine Plattenspieler und Tonarme, die freilich nicht immer die hauseigene "Consonance"-Marke tragen, sondern durchaus auch mal High-End-Namen aus England, den USA oder Neuseeland: Alle neueren Well-Tempered-Spieler, beginnend mit dem überragenden Amadeus, entstehen laut Well-Website bei "our good friends in Beijing".
Opera Audio Isolde: Aufbau
Im Opera-eigenen Spielerprogramm heißt der Einstieg "Isolde" nach einer Figur aus Wagners "Walküre" - und kommt für 1700 Euro richtig gewichtig daher, mit einer wunderschönen Zarge betont klassischen Zuschnitts. Sie besteht aus einem massiven Block hochverdichteter Faserplatte, eingerahmt von ebenso massivem Kirschholz und oben belegt mit einem dicken Furnier aus demselben Material. Hohlräume haben die Chinesen nur da hineingefräst, wo sie dringend benötigt werden, etwa für Motorsteuerung, Armbasis oder Tellerlager.

Ein Subchassis gibt es nicht; Tonarm, Tellerlager und Motor sind fest mit dem erwähnten Holzblock verschraubt, der seinerseits auf vier höhenverstellbaren, soliden Alufüßen thront. Zwischen diesen und dem Holz sitzen aber noch - aufgepasst! - vier Squashbälle, die das ganze Chassis sehr effektiv vom Untergrund entkoppeln.
Motor und Riemen
Ein messtechnisch wie akustisch sehr leise laufender Gleichstrommotor sorgt für Vortrieb, ein Kunststoff-Flachriemen überträgt die Kraft auf den Außenrand des Tellers. Opera legt netterweise gleich zwei dieser Riemen bei; beim Testgerät waren sie in einem gemeinsamen Plastiktütchen eingezwängt und nach dem Auspacken erstmal ein wenig verzogen.
Der daraus resultierende optisch etwas unruhige Lauf des Riemens verunsichert anfangs, gibt sich aber nach wenigen Spieltagen vollständig und weicht einem so stabilen Dahingleiten, dass man aus zwei Metern Entfernung nicht mehr ohne weiteres erkennen kann, ob der Spieler läuft oder nicht.
Plattenteller
Der Teller selbst besteht aus seidenmatt gestrahltem Acryl und ist fest mit der Lagerachse verpresst. Beim Zusammenbau bekommt man den Eindruck, dass die Achse für ihre (Messing-) Buchse einen Tick zu klein ist: Das Lager hat etwas Spiel. Genauere Betrachtung offenbart, dass dieses Spiel nicht von zu großen Toleranzen herrührt, sondern von einer Richtung Lagerboden offenbar bewusst etwas weiter ausgedrehten Buchse.

Während die Welle also oben absolut akkurat geführt wird, hat sie am unteren Ende, wo sie auf einer Keramikkugel aufsitzt, ein gewisses Maß an lateraler Bewegungsfreiheit. Erst die Riemenspannung zieht das Konstrukt in eine stabile Lage - das Ganze erinnert an eine vereinfachte Adaption der Well-Tempered-typischen Fünfpunkt-Lager, und vielleicht hat sich Herr Shi Hui Liu, der Firmengründer und Chefkonstrukteur, tatsächlich ein wenig von seinen neuseeländischen Freunden und Auftraggebern inspirieren lassen. Fest steht jedenfalls, dass das Lager weder im Gleichlauf noch im Rumpeln irgendwelche Auffälligkeiten zeigte, solange man darauf achtete, dass es stets möglichst vollständig mit dem mitgelieferten Öl gefüllt war.
Tonarm
Präzise Fertigung und makellose Funktion fanden wir auch beim serienmäßigen Tonarm T8, einer 100-prozentigen Opera-Eigenentwicklung. Dass die Pekinger nicht zu bewährt-langweiligen Zulieferern a la Rega oder Jelco greifen, ist erfrischend und verdient Lob, zumal der T8 absolut nicht gebastelt wirkt, sondern einen richtig high-endigen Eindruck macht: Alle Einstellmöglichkeiten (inclusive der vor allem für weniger perfekte Tonabnehmer wichtigen Azimuth-Justage) sind da und sinnvoll nutzbar, der minimalistische Headshell-Querbalken gibt dem Tonabnehmer bombenfesten Halt, und das Lagerspiel bekommen die Zukauf-Konkurrenten zumindest bei ihren erschwinglichen Modellen auch nicht besser hin.

Mit neun Gramm effektiver Masse ist der T8 ein eher leichter Arm - und mag auch keine Abtaster mit zu hohem Eigengewicht, die er mit seinen Alu-Gegengewichten nicht mehr gescheit ausbalanciert bekommt. Das für die Messung verwendete Benz Ace (9g) geht gerade noch, besser passt jedoch das im Hörtest verwendete Ortofon 2M mit 7g Eigengewicht. Aufbau und Montage des Spielers verliefen problemlos, neben einem passenden Tonabnehmer ist allerdings eine Tonarmwaage zwingend erforderlich und nicht mitgeliefert. An die aktuell etwas hemdsärmelige, aber durchaus reizvolle stufenlose Drehzahlverstellung über ein Wendelpoti am Heck muss man sich gewöhnen, aber immerhin liefert Opera eine schöne, große Kunststoff- Stroboscheibe mit.
Hörtest
Letztere nach erfolgter Drehzahljustage einfach umzudrehen und als Matten-Ersatz zu verwenden, erschien AUDIO aber nicht sinnvoll - auch wenn die Anleitung das empfiehlt. Die Plastikscheibe ist völlig plan, hat also auch keine Aussparungen für eventuell etwas erhabene Label und Randbereiche und bewirkte selbst mit modernen Platten ohne Mittelplateau und Randwulst einen etwas diffusen, trotz insgesamt eher warmem Timbre wenig entspannten Klang. Klar stimmiger spielte Isolde, wenn man ihm/ihr das Vinyl direkt auf dem Acrylteller servierte oder wahlweise auf einer klassischen Woll-Filzmatte anrichtete.
Die Entscheidung zwischen den beiden Varianten darf nach Geschmack fallen: Mit Filz wirkte es im Bass etwas präziser, ganz "ohne" im Mittelton einen Hauch ausdrucksstärker. So oder so wirkte der Opera-Spieler nun enorm entspannt. Decemberists-Sänger Colin Meloy konnte auf "Shankill Butchers" (vom grandiosen Doppelalbum "The Crane Wife") nach Leibeskräften krähen, ohne dass dem Opera auch nur das kleinste Halldetail hinter seiner Stimme entging oder sich sonst irgendeine Form von Stress bemerkbar machte - der chinesische Dreher glitt unbeirrt von Song zu Song, von Album zu Album, blieb stets Herr der Lage und entzückte mit riesiger Bühne, vollem, sonorem Bass- und Grundtonbereich sowie einem stets milden, feinen und ausgewogenen Farbenspektrum.

Wer eine optimale Standfläche hat (etwa auf einem guten Wandhalter), kann auch versuchen, auf die Squashball-Dämpfung ganz zu verzichten, den Spieler also z. B. mit kleinen Spikes oder Hartgummifüßen tieferzulegen. Das zahlt sich in einem aufgeräumteren, besser strukturierten Bass aus, muss aber für viele Hörer gar nicht sein. Letztlich ist es gerade der blumige, weiche, ja: ein bisschen altmodische Klang, der den Opera zu einer reizvollen Alternative macht - auch gegenüber dem Überflieger-Kollegen von input audio aus der Audio 8/2014, der im Direktvergleich objektiv noch dynamischer und knackiger durchzog. Was der distinguiert-eleganten Spielweise des Opera nichts von ihrem Zauber nimmt.