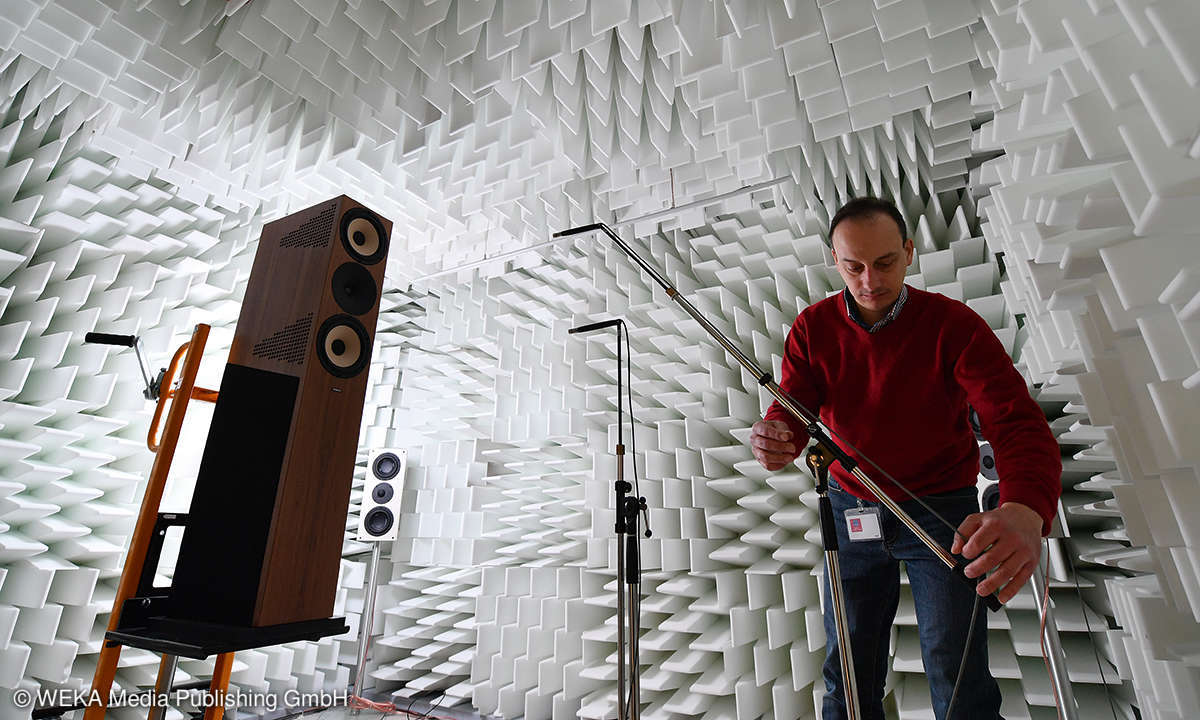Das Zusammenspiel von Tonabnehmer und Phonovorverstärker
Das Teamwork von Tonabnehmer und Phonoverstärker ist kein Hexenwerk, aber auch von subjektiven, nach Gehör ermittelten Einstellungen an heutzutage höchst bequem ausgestatteten Phono-Amps geprägt.

- Das Zusammenspiel von Tonabnehmer und Phonovorverstärker
- Abschluss und Anschluss
- Resonanz und Frequenzgang
Dieser Ratgeber widmet sich dem Teamwork von Tonabnehmer und Phonovorverstärker, das geprägt ist von sehr kleinen (Signal-)Wechselspannungen. Bei den in der Praxis noch wenig problematischen MM-Tonabnehmern geht es nämlich um Signale in der Größenordnung von ein paar Milliv...
Dieser Ratgeber widmet sich dem Teamwork von Tonabnehmer und Phonovorverstärker, das geprägt ist von sehr kleinen (Signal-)Wechselspannungen. Bei den in der Praxis noch wenig problematischen MM-Tonabnehmern geht es nämlich um Signale in der Größenordnung von ein paar Millivolt (das sind Tausendstel Volt), während die Ausgangsspannung von Moving-Coil-Tonabnehmern nochmals um den Faktor fünf bis zehn geringer ausfällt.
So ist beispielsweise für das MC-System EMT JSD6 eine Nenn-Ausgangsspannung von einem Millivolt pro Kanal angegeben, wobei man sich auf eine definierte Auslenkung (üblicherweise 1000 Hertz oder 400 Hertz bei 5 cm/Sekunde) der Plattenrille bezieht. Damit zählt das EMT noch zu den "lauten" MC-Abtastern, ganz im Gegensatz etwa zum "leisen" Ortofon SPU Classic, für das lediglich 0,2 Millivolt Nenn-Ausgangsspannung angegeben werden.
Vergegenwärtigt man sich nun, dass sehr leise Töne von der Schallplatte durch die geringe Auslenkung nochmals sehr viel weniger Ausgangsspannung erzeugen, dann ist es fast ein Wunder, dass wir überhaupt verwertbare Signalspannungen erhalten. Unter Audio-Elektronikern spricht man hier scherzhaft davon, dass dann nur noch eine "Handvoll Elektronen" aus dem winzigen Generatorsystem "herauskullern", womit klar ist, dass der "Signal-to-Noise", also der Abstand zwischen Stör- und Nutzsignal, beginnt, eine gewaltig große Rolle zu spielen.
Das Prinzip von Tonabnehmern
Das Prinzip von MM- und MC-Tonabnehmern ist altbekannt und stellt die winzige Ausgabe eines elektrischen Generators dar. Dabei wird mechanische Leistung in elektrische umgewandelt.

Dafür verantwortlich ist die Lorentzkraft: Bewegt sich ein Leiter senkrecht zu einem Magnetfeld, versetzt die Lorentzkraft die Ladungen im Leiter in Bewegung, was in einer Potenzialdifferenz zwischen Anfang und Ende des Leiters resultiert, die wiederum eine elektrische Spannung darstellt.
Das Gesetz dazu ist relativ einfach: Je größer die Flächenänderung (durchlaufene Strecke im Magnetfeld) pro Zeiteinheit ist, desto höher ist die elektrische Spannung. Und wer sich nun die fast hausgroßen Generatoren eines mittelprächtigen Kraftwerks heutiger Tage ansieht, kann sich vielleicht lebhaft vorstellen, wie ungeheuer winzig jene Wechselspannung ausfällt, die aus einem MC-Tonabnehmer kommt. Eine kleine 1,5-Volt-Batterie ist dagegen schon ein echtes Monster mit tausendfach höherer Ausgangsspannung.
Winzige Spulen
Damit leuchtet ein, von welchen Faktoren die Ausgangsspannung abhängt:
- von der Stärke des Magnetfelds,
- von der Anzahl der Spulenwindungen und
- von der Auslenkung.
Da es bei Tonabnehmern aber darum geht, die bewegte Masse zu minimieren, bestehen die bewegten Spulen (MC-System) aus nur wenigen Windungen feinsten Kupferdrahtes. Ebenso dürfen die bewegten Magnete eines MM-Abtasters nicht beliebig groß ausfallen, damit der Nadelträger noch verzögerungsfrei den Auslenkungen der Plattenrille folgen kann. Und wir müssen das Ganze, damit es funktioniert, in vier Richtungen beweglich "aufhängen" - und bauen damit ein Federsystem, das den Gesetzen der Physik folgt: kein Federsystem ohne Eigenresonanz?
Genau damit handelt man sich aber einige Probleme ein, auf die wir noch zu sprechen kommen.