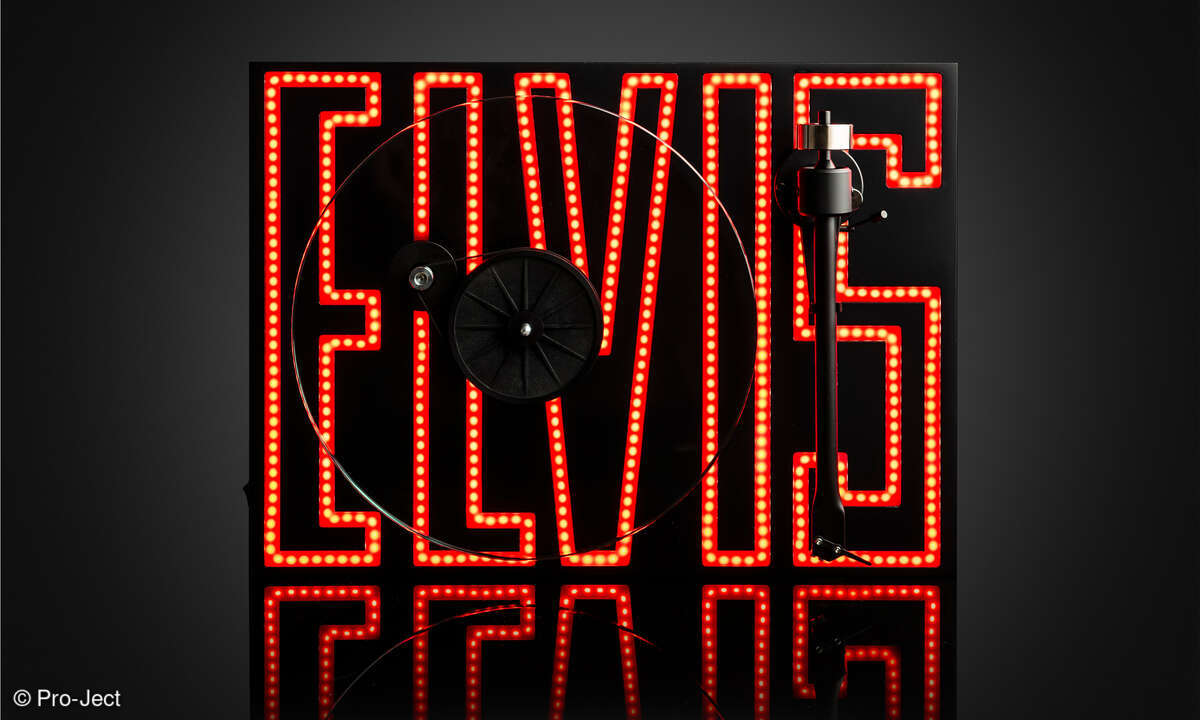Scheu Analog Cello Maxi im Test
Scheu Analog baut schon seit 1985 Plattenspieler und verkauft sie in die ganze Welt. Selbst Katie Melua besitzt einen (Black Diamond). Wir schauen uns den wunderhübschen Cello Maxi in Rot genauer an.

Aus Unzufriedenheit mit den Plattenspielern, die man im Handel kaufen konnte, fing Thomas Scheu, Werkzeugbauer und Musiker, 1985 an, einen Plattenspieler für sich zu bauen. Schon nach kurzer Zeit baute Scheu für Freunde und Bekannte, bald gründete er seine Firma. Seit seinem Tod 2004 ist die Firm...
Aus Unzufriedenheit mit den Plattenspielern, die man im Handel kaufen konnte, fing Thomas Scheu, Werkzeugbauer und Musiker, 1985 an, einen Plattenspieler für sich zu bauen. Schon nach kurzer Zeit baute Scheu für Freunde und Bekannte, bald gründete er seine Firma. Seit seinem Tod 2004 ist die Firma in den Händen von Ulla Scheu, die mit der Firma auch von Solingen nach Berlin gezogen ist, und das Geschäft sehr erfolgreich führt.
Der Cello ist das Einsteigerlaufwerk bei Scheu Analog. Man sieht das etwa am eingesetzten Tonarm, der hier von Rega stammt und auf den Namen RB 220 hört, sowie am Tonabnehmer in der Headshell, einem Ortofon Super OM 10. Davon abgesehen finden sich hier aber nur hochwertige Komponenten, etwa das Lager, das so auch im Premier seinen Dienst verrichtet.
Es gibt den Cello in zwei Ausführungen: Die „normale“ Version hat einen 30 mm hohen Acrylteller (2,5 Kilo, matt) und kostet inklusive Tonabnehmer 1895 Euro. Unser Testgerät heißt Cello Maxi, hat auf vielfachen Kundenwunsch einen 50 mm hohen Teller (4,7 Kilo, matt) und kostet 2180 Euro inklusive Arm und Tonabnehmer.
Wer eine blaue oder rote Zarge möchte, zahlt 120 Euro Aufpreis, wer eine weiße oder schwarze Zarge möchte, zahlt 65 Euro Aufpreis. Nimmt man diese Option nicht wahr, ist das Gerät komplett transparent. Uns gefällt die Kombi aus Rot und Weiß sehr gut, wie hochwertig das Laufwerk wirkt, kommt auf Fotos aber nur bedingt rüber. Da der Rega ein klassischer 9-Zoll-Arm ist, ist die Zarge schön kompakt.

Sie misst 42 cm in der Breite und ist 34 cm tief. Der Cello passt überall hin. Die Acryl-Zarge ist unabhängig von der Ausführung 1,5 cm stark und steht auf drei Füßen. Der hintere ist ein höhenverstellbarer Spike mit Unterlegscheibe, der Fuß vorne rechts ist optisch an den linken Fuß angepasst, der wiederum gleichzeitig die Motordose ist. Hier arbeitet ein bürstenloser und PLL-geregelter, also mit Phasenregelschleife arbeitender Gleichstrommotor. Die Tellergeschwindigkeit wird mit einer Referenz verglichen und bei Bedarf nachgeregelt.
Zudem kann man getrennt für 33 1/3 und 45 RPM die Geschwindigkeit mit einem kleinen Schlitzschraubendreher feintunen. Der Kippschalter lässt sich von seiner Mittelstellung nach links (33 1/3) und rechts (45) kippen. Die vorderen Füße sind übrigens über Gummiringe von der Zarge entkoppelt, was Schwingungen sowohl des Motors als auch der Stellfläche von der Zarge fernhalten soll. Der Aufbau ist recht simpel. Da der Motor ja auch schon abseits vom Tellerlager seinen Dienst verrichtet, ist das auch logisch.
Es braucht dann keinen mehrlagigen Schichtaufbau, um zu guten Messwerten zu gelangen. Folglich trägt die Zarge das invertierte Tellerlager bzw. dessen Lagerachse. Das Gegenstück, die Hülse, steckt im Teller. In einer kleinen Mulde auf der Spitze der Achse ruht die Keramik-Lagerkugel. Sie hat direkten Kontakt zum Lagerboden, der hier also eher ein Lagerdach ist und aus einer kleinen Teflonscheibe besteht. Dieses Lager findet sich auch im großen Laufwerk „Premier“ und ist seit Jahren erprobt und absolut zuverlässig. Unsere Rumpelmessungen belegen das: 72 dB Rumpelabstand mit Platte und 76 dB mit Messkoppler sind sehr gute Werte!

Acrylteller
Der Teller besteht wie die Zarge aus Acryl, ist in der Maxi-Ausführung fünf Zentimeter stark und viereinhalb Kilo schwer. Eine Tellermatte liegt nicht bei, Ulla Scheu empfiehlt die Verwendung des nackten Tellers. Angetrieben wird dieser über einen dünnen String, genauer: einen Faden aus Polyamid.
Entscheidend für diese Wahl seien die klanglichen Auswirkungen, für die Praxistauglichkeit und eine zügige Inbetriebnahme ist das aber eher nicht so eine gute Wahl: Zunächst gilt es, von der 200-m-Rolle ein Stück abzuschneiden (die Bedienungsanleitung hilft) und dieses dann durch mehrere Knoten auf die richtige Länge zu kürzen.
Das ist etwas fummelig, Gleiches gilt für das Umlegen des Riemens um Teller und Pulley, aber das macht man ja nur sehr selten, nämlich einmal zur Inbetriebnahme und ansonsten nur, wenn man den Teller abnimmt, also um zu ölen oder den Plattenspieler zu transportieren. Empfohlen wird eine eher geringe Riemenspannung, um den bestmöglichen Gleichlauf zu erreichen. Doch schnell noch ein paar Worte zum Arm.
Rega RB 220
Der Rega RB 220 ist der Nachfolger des 202, der wiederum der Nachfolger des legendären RB 250 war. Dass es ein Rega ist, sieht man sofort, nicht zuletzt an der praktischen Dreipunktbefestigung, mit der hauseigene Tonabnehmer (abgesehen vom Rega Carbon) blitzschnell und ohne weitere Justage eingebaut werden können! Das ist wirklich eine tolle Sache, man kann aber auch so gut wie jeden anderen Tonabnehmer hier einschrauben. Das Tonarmrohr geht ohne Übergang in die Headshell über, besteht aus resonanzoptimiertem Aluminium und ist neu entwickelt worden, die Lager sind nun noch reibungsärmer und der Arm wird von Hand montiert.

Das Phonokabel ist fest montiert und von ordentlicher Qualität. Wir finden, das ist ein super Arm, mit dem man erstmal zufrieden sein kann. Irgendwann aber kann man auch ruhig über ein Upgrade nachdenken. Zum Beispiel eines von Scheu Analog... Angeschlossen an den Luxman L-509X, durfte der Cello zunächst mit Ortofon Super OM 10 loslegen. Auffallend war die für einen so günstigen Tonabnehmer (um 100 Euro) ungewöhnlich gute Stimmwiedergabe. Hier haben wohl Arm und Laufwerk ein Wörtchen mitzureden.
Dennoch wollten wir das Laufwerk weiter ausreizen und schraubten ein Ortofon 2M Black LVB 250 ein (um 1000 Euro). Dieses System, das Ortofon anlässlich des 250. Geburtstags Ludwig van Beethovens 2020 auf den Markt brachte, ist eines der besten MMs der Welt und verfügt über einen sehr steifen Bor-Nadelträger sowie einen Diamant mit Shibata-Schliff.
Und siehe da: Der Vortrag wurde erwachsener, der Raum größer, die Musik farbiger. Der Abstand zu einem eher zufällig im Hörraum befindlichen Pro-Ject Debut Pro mit Pick it Pro wurde nun noch größer: So gut der Pro-Ject für sich genommen spielte, so chancenlos war er gegen den (erheblich teureren) Scheu.
Der Cello bietet einen deutlich größeren Raum, mehr Bassdruck, feinere und strahlendere Höhen. Das zeigt sich etwa bei Art Blakeys „Afrique“ (Tone Poet), wo das Trio aus Scheu, Rega und Ortofon LVB 250 die Musiker präzise platzierte und die Musik sehr lebendig wiedergab. Erfreulicherweise zeigte sich keinerlei Nervosität aufseiten des Plattenspielers – was diesem Stück auch schnell den Rest geben würde.

Ausgewogen spielt der Scheu auch mit dem kleinen Ortofon, aber mit dem großen Ludwig in der Headshell können Arm und Laufwerk viel besser zeigen, wozu sie fähig sind. Etwa zu farbigem, präzisem Bass, der nun viel besser herauszuhören ist. Oder zu mittreißenden Mitten, etwa auf John Frusciantes genialem Album „Curtains“ von 2004.
Der On/Off-Chili-Peppers-Gitarrist hat eine eher nasale Stimme – und er schreibt sehr gute Texte, die wohl kein anderer besser wiedergeben könnte. Und so lächeln die Zuhörer zu Beginn von „The Past Recedes“ vor Begeisterung. Die Mienen werden im Verlauf aber ernster, was schlicht daran liegt, dass Scheu, Rega und Ortofons Ludwig eine wunderbare Ehe eingehen und Musik nicht nur mitreißend und natürlich, sondern auf Wunsch auch sehr emotional wiedergeben.
Fazit
Schon in der Plug-and-Play-Version mit kleinem Ortofon-MM ist der Scheu Cello ein super Plattenspieler. Die tadellosen Messwerte werden ergänzt durch einen ausgewogenen Klang mit einer tollen Stimmwiedergabe. Mit einem besseren Tonabnehmer entfaltet der Cello aber mehr Magie: Der Raum ist viel größer, der Klang hat mehr Volumen, ist sauberer und die Musik kommt einfach emotionaler und mitreißender rüber. Es muss nicht gleich ein 1000-Euro-System sein, aber dank des sehr guten Arms ist hier vieles möglich.