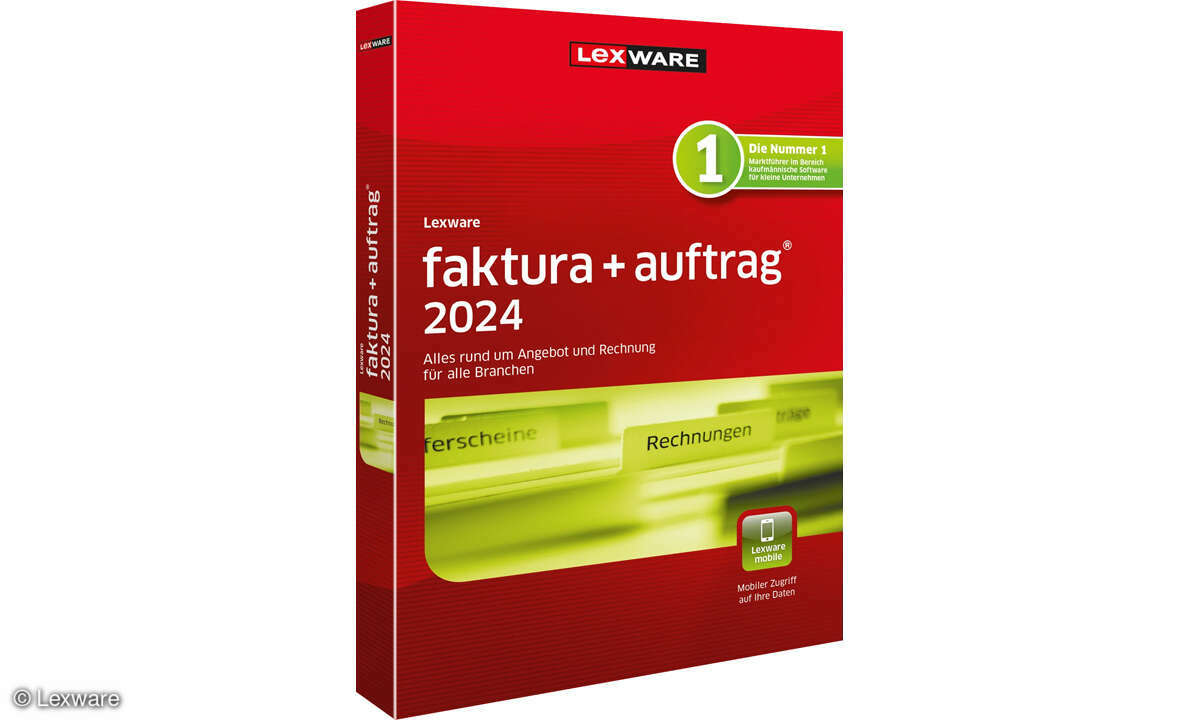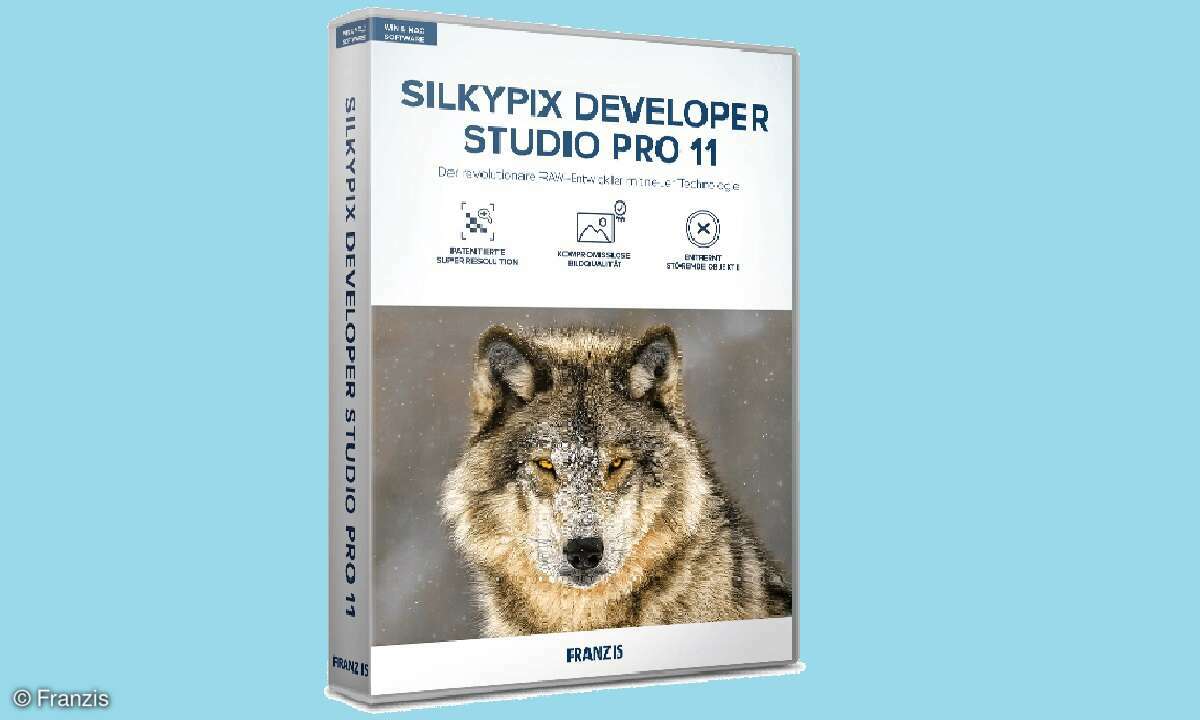KEF Blade
KEF betreibt die eigene Philosophie so radikal wie nie zuvor: die neue Blade soll das Ideal der perfekten Punktschallquelle erreichen. Klingt die elegante Skulptur so organisch und grazil, wie sie aussieht?

- KEF Blade
- Datenblatt
Kaum ein Lautsprecherhersteller stellt ein einziges Konstruktionsprinzip so hartnäckig wie KEF in den Mittelpunkt, und arbeitet dennoch fortwährend daran: Seit man das erste Koax-Chassis namens UniQ einführte, hat es unzählige Varianten und Verbesserungen. Die Idee, sämtlich...
Kaum ein Lautsprecherhersteller stellt ein einziges Konstruktionsprinzip so hartnäckig wie KEF in den Mittelpunkt, und arbeitet dennoch fortwährend daran: Seit man das erste Koax-Chassis namens UniQ einführte, hat es unzählige Varianten und Verbesserungen. Die Idee, sämtliche für die Ortung relevanten Schallanteile aus einem einzigen akustischen Zentrum zu erzeugen und somit Abbildung wie Schallabstrahlung zu perfektionieren, erwies sich für die KEF-Ingenieure beinahe als Lebensaufaufgabe.
Irrungen und Wirrungen
Dabei erschienen vor allem die kleinen 2-Wege-Modelle als die konsequentesten, die dem Ideal der Punktschallquelle so nahe kamen wie sonst höchstens Breitbänder (die akustisch andere Nachteile aufweisen). Die Spitzenmodelle, allen voran die im Jahr 2004 eingeführte Reference 207, war aus Sicht der Akustik von bemerkenswerter Inkonsequenz: Nicht nur, dass der UniQ im Stimmbereich von einem Grundtöner Unterstützung benötigte, man baute der rundgeformten Box auch noch zusätzliche Bässe und einen aufgesetzten Superhochtöner ein.
Kann man eine 5-Wege-Konstruktion ernsthaft als Punktschallquelle bezeichnen, selbst wenn ihr Herzstück ein Koaxialtöner ist? Diesen Widerspruch versuchten die KEF-Entwickler fortan aufzulösen, erweiterten den Einsatzbereich des UniQ und ließen den Superhochtöner wieder weg. Doch erst im Jahr 2008 machte man sich an die Idee, ein Boxenkonzept mit einer auch konzeptionell perfekten Punktschallquelle zu entwickeln.
Ohne Ecken und Kanten
Wie bei den KEF-Superboxen üblich - man denke an die Maidstone und die Genesis des Austin-Projektes, das zur Muon führte - wurde diese Studie zunächst ohne Rücksicht auf eine spätere praktische Verwendbarkeit konstruiert. Heißt auf gut Deutsch: Geld, Zeit und Konventionen spielten keine Rolle. Gebaut wird, was akustisch notwendig und sinnvoll ist, und wenn Messungen oder Hörtests andere Wege nahelegen, dann wird eben weiter geforscht und gebaut. Das nutzten die Entwickler in mehrfacher Hinsicht voll aus: Für das Gehäuse, aber auch für das zentrale Koaxialchassis, eine völlig neue Generation UniQ.

Beide folgten den Vorgaben einer idealen Punktschallquelle, und bei beiden steigerte sich der Aufwand schnell ins Unermessliche. Der Gehäuseaufbau hat mit einer klassischen Box kaum mehr etwas gemein. Statt einer Kiste mit Frontwand und Seitenteilen eine einzige große Schallwand, die den erzeugten Wellen keinerlei Kanten, Hindernisse und Brechungsflächen entgegensetzt, sondern eine harmonische Ausbreitung fördert. Ganz im Sinne einer akustisch unendlichen Schallwand.
Man hätte also auf einer Schallwand ein Koaxialchassis für Mittel- und Hochton benötigt sowie vier Bässe kreisförmig darum verteilt - das sorgt dafür, dass das Ohr alle Frequenzen aus demselben Punkt ortet. Hifitechnisch ideal, aber eine Scheibe von einem oder anderthalb Meter Durchmesser wäre nun selbst für eine Projekt-Box absolut nicht praxistauglich. Zumal die KEF-Entwickler seit dem Projekt Austin/Muon auch dahinter gekommen waren, dass eine möglichst schmale, sanft verrundete Schallwand die Abstrahleigenschaften des Chassis besser zur Geltung bringt als eine klassische breite Schallwand und auf diese Weise genauer abbildet.

Für die Blade verband man einfach beide Ideen und bog eine Schallfläche mit fünf Wandlern sanft um die Front herum und erhielten eine sehr schmale, skulpturähnliche Form, die akustisch aber, bis auf eine leichte Aufweitung der Mitteltonabstrahlung, die segensreichen Eigenschaften der unendlichen Schallwand inklusive dem Fehlen jeglicher Kantenreflexionen beibehalten soll. Die vier Basstreiber wanderten natürlich auf die Seiten des Gehäuses, womit die Funktion der virtuellen Punktschallquelle aber erhalten bleibt. Ein weiterer akustischer Vorteil ergibt sich aus dieser Biege-Aktion: die linken und die rechten Bässe arbeiten nun um 180 Grad versetzt, und etwaige Impulse, die sie auf das Gehäuse abgeben - umgangssprachlich könnte man auch vom Rückstoß sprechen - löscht sich damit vollkommen aus.
Um diesen Effekt noch zu perfektionieren, verbanden die Gehäusenentwickler sowohl die beiden Seitenteile der Box als auch die Chassis selbst mit Verstrebungen. Soweit, so gut für die Prototypenhersteller. Denn mit konventionellen Methoden wie Schichtverfahren ließ sich eine solche Skulptur nicht mehr fertigen. Während man bei der Muon auf verformtes Aluminium gesetzt hatte, wurde der Blade-Prototyp aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt, wobei Front und Seitenteile natürlich aus einem Stück gegossen werden müssen.
Alles aus der Mitte
Dabei war die Gehäuseentwicklung gar nicht alles: parallel zum Konzept entstand eine neue Generation UniQ-Chassis. Kleiner als der Koax von Muon und Reference-Serie, sollte er dennoch nahtlos bis zur Übergabe an die Basstöner spielen. Eine flache Sicke hätte nicht genug Hub erlaubt, deshalb erfand man eine gefaltete Version, die nahtlos zum Gummi-Waveguide übergeht.

Schmale Boxen neigen akustisch zu einer eher breiten Abstrahlung und klingen oft räumlich breit, zu den Seiten ausgedehnt, dafür aber noch tendenziell diffus und unkonkret. Ein solches Klangbild hatte ich intuitiv auch von der von vorne völlig schmalen Blade erwartet. Doch nichts da: Die Bühne bei Mahlers 4. Sinfonie (Gürzenich Orchester, Oehms) baute sich perfekt gestaffelt zwischen den beiden Skulpturen auf, glänzte dabei mit einer kaum je dagewesenen Ortungsnatürlichkeit.
Praxis: Lautsprecher richtig aufstellen
Jedes Instrument war in Breite und Tiefe an seinem Platz, der Raum bis in die letzten Ecken natürlich ausgeleuchtet, ohne dass man das Gefühl hatte, hier sei ein Lautsprecher am Werke. Dabei veranstaltete die Blade allerdings auch keine Effekthascherei und blies den Raum auch nicht künstlich auf, sondern beließ die Abbildung so, wie sie auf der Aufnahme ist. Assoziationen an die besten koaxialen Nahfeldmonitore stellten sich mir ein, allerdings ganz ohne dieses Gefühl der zu hohen Klangpräzenz. Denn die Blade zeigte auch gegenüber ihrer etwas bauchigeren Schwester, der Reference 207/2, ein ähnlich neutrales, ähnlich fein aufgelöstes Klangbild, das allerdings mit einem Mehr an Transparenz und Seidigkeit am Ohr punktete. Wo die Reference sich eher als Studiomonitor gerierte und Details der Aufnahme genaustens offenlegte, stellte die Blade diese mit betont unaufgeregter Lockerheit in den Raum.

Ein zweites Vorurteil gegen schlanke Boxen räumte sie noch schneller aus: das eines zu dünnen Tiefbasses. Das Pfund, dass die schmale Box untenrum bewegen kann, ist schier unglaublich, wobei es bei Joe Satrianis "Engines of Creation" weniger die Masse an Tiefton war, die beeindruckte, als vielmehr dessen Kontrollierheit, das rhythmsiche Feingefühl gepaart mit schwärzester Tiefe und guter Durchsetzungskraft.
Kaufberatung: Vollverstärker im Test
Die Reference 207/2, obgleich laut gespielt etwas dynamischer und knalliger, wirkte bei moderaten Abhörpegel schon fast eine Spur zu fundamentarm im Vergleich. Klangfarblich und von der Auflösung her schenkten sich beide Schwestern nichts: Doch im Charakter der Darbietung unterschieden sie sich, die Reference eher nüchtern-genau, die Blade lockerer und sanfter, ohne dass sie je ins Schmeichlerische oder gar Schönfärberische abgeglitten wäre.
Das wäre auch das Einzige, was man überhaupt kritisieren kann: wenn die Pegel extrem wurden und ein lautes Metal-Brett gefragt war (hier: Metallicas "Sad but true"), enthielt sie sich im Mittelton der Kraftmeierei und ließ bei allem Sinn für Rhythmus und Dynamik das letzte Quentchen Aggressivität und Kraft vermissen. So, als sei sie eigentlich zu kultiviert für derlei Musikgenres. Deshalb zum Abschluss ein audiophiles Paradestück und ein echter Durchmarsch für die Blade: "Walking on the moon" in der Saxophon-Version des Yuri Honing Trios.
Plastisch und beänstigend realistisch stellte sie das extrem dynamisch geblasene Solo-Instrument in den Raum, folgte den mitunter kräftigen Ausflügen von Bassdrum und Kontrabass in unterste Regionen. Wunderbar ihre Transparenz bei den Saxophon-Kapriolen, die trotz strahlender Klangfarben und kräftigem Antritts niemals aggressiv oder unangenehm tönten. Die Musik klingt so, wie sie ist und wie sie sein soll - auf den Punkt.
Fazit
Die Blade ist kein Design-Gag, sondern die durchdachteste Gesamtkonstruktion, die ich im Lautsprecherbereich kenne. Sie zeigt, wie ein theoretisch überlegenes Konzept mit jahrzehntelanger Entwicklungsarbeit auf die Spitze getrieben wird, bis es nichts mehr zu verbessern gibt. Eine Hörsession mit ihr ist wie eine Lehrstunde: Man erlebt, wie Aufnahmen wirklich klingen; man lernt, dass detaillierte Auflösung und akustisches Wohlfühlen keine Widersprüche sind; und sie zeigt, dass ein sensationell neutraler Speaker Rhythmusgefühl und Spaß freisetzen kann. Wenn ich eine Box aus dem AUDIO-Testfundus mit nach Hause nehmen dürfte - es wäre die Blade.
KEF Blade
| KEF Blade | |
|---|---|
| KEF Blade | |
| Hersteller | KEF |
| Preis | 25000.00 ? |
| Wertung | 105.0 Punkte |
| Testverfahren | 1.0 |